Benutzer Diskussion:Definitiv – Wikipedia
Willkommen in der Wikipedia!
Für den Anfang ein paar Tipps, um dich in Wikipedia möglichst schnell zurecht zu finden.
| Schritt-für-Schritt-Anleitung für Artikelschreiber | Wie man gute Artikel schreibt | Weitere Hinweise für den Anfang | Wenn du Fragen hast |
|---|
- Wenn du eigene Artikel schreiben möchtest, kannst du dir viel Frust ersparen, wenn du zuvor einen Blick auf Was Wikipedia nicht ist und die Relevanzkriterien wirfst. Nicht alle Themen und Texte sind für einen Artikel geeignet.
- Solltest du bestimmte Wörter oder Abkürzungen nicht auf Anhieb verstehen, schau ins Glossar.
- Wenn du Bilder hochladen möchtest, achte bitte auf die korrekte Lizenzierung und schau mal, ob du dich nicht auch in Commons anmelden möchtest, um die Bilder dort zugleich auch den Schwesterprojekten zur Verfügung zu stellen.
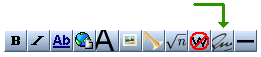
- Bitte wahre immer einen freundlichen Umgangston, auch wenn du dich mal ärgerst. Um in Diskussionen leicht zu erkennen, wer welchen Beitrag geschrieben hat, ist es üblich, seine Beiträge mit
--~~~~zu signieren. Das geht am einfachsten mit dem auf dem Bild hervorgehobenen Knopf.
- Sei mutig, aber vergiss bitte niemals, dass sich hinter anderen Benutzern Menschen verbergen, die manchmal mehr, manchmal weniger Wissen über die Abläufe hier haben. Herzlich willkommen! --Donautalbahner 17:51, 30. Dez. 2007 (CET)
Friedrichsvorstadt
[Quelltext bearbeiten]Hallo, danke für den Artikel. Ich hoffe, ich habe beim Reparieren der Literaturangaben (siehe Wikipedia:Literatur) das richtige Werk von Leyden erwischt; du könntest bitte nochmal drüberschauen. Gruß, — PDD — 11:44, 7. Apr. 2008 (CEST)
- Ja, das ist garantiert die richtige Bezeichnung. Im übrigen Danke für die Korrektur meiner Anfängerfehler! --Definitiv 12:30, 7. Apr. 2008 (CEST)
Einfach mal zwischendurch: Danke!
[Quelltext bearbeiten]Hallo Definitiv, vielen Dank für Deine wirklich konstruktive Mitarbeit an den Seiten Berlins, die ich gerne mitbetreue. LG Detlef. --Emmridet 10:59, 19. Jun. 2008 (CEST)
- Danke, freut mich sehr. Der Ansporn dazu war übrigens der Artikel über Friedenau. Danke auch fürs gründliche Gegenlesen. LG -- Definitiv 11:11, 19. Jun. 2008 (CEST)
- Na da haben sich ja zwei gefunden... Weiter so und LG Detlef. --Emmridet 11:25, 19. Jun. 2008 (CEST)
BT WK Hochtaunus
[Quelltext bearbeiten]Du hattest dankenswerterweise die fehlenden Wahlkreisabgeordneten ergänzt. Was ist die Quelle (ggf. sogar online verfügbar für die anderen Wahlkreise)?Karsten11 21:53, 10. Jul. 2008 (CEST)
- Ich hab einfach bei Liste der Mitglieder des Deutschen Bundestages (1. Wahlperiode), Liste der Mitglieder des Deutschen Bundestages (2. Wahlperiode) usw. nachgeschaut; bei der 49er-Wahl muss man dann noch ein bisschen kombinieren da dort die Wahlkreise keine bundesweit durchgehende Nummerierung hatten. Man kommt dann drauf, dass 1949 der Obertaunus die hessische Wahlkreisnummer 10 hatte. So kann man eigentlich alle bisherigen Wahlkreisabgeordneten identifizieren. Noch leichter wird es, wenn sich ein Held der Kleinarbeit mal daran macht, in der Liste der Mitglieder des Deutschen Bundestages (1. Wahlperiode) beim jeweiligen Wahlkreis auch noch das jeweilige Bundesland zu vermerken ;-) Grüße -- Definitiv 22:16, 10. Jul. 2008 (CEST)
Rossstraßenbrücke
[Quelltext bearbeiten]Hallo Definitiv, selbstverständlich akzeptiere ich deine entsprechenden änderungen. Nur mit den hinweisen auf die namen stimme ich dir nicht zu (auch wenn's hier in wiki anders steht): 1) Neukölln am Wasser wird in einem seriösen Buch (Die Bau- und Kunstdenkmale der DDR, Berlin, I; Hrsg. Institut für Denkmalpflege im Henschelverlag, Berlin 1984) als das entsprechende stadtviertel bezeichnet (S. 236: Neukölln am Wasser und Luisenstadt). Das gleiche trifft auf die schreibweise der o.g. brücke zu: in dem unter literatur angegebenen buch steht es mit doppel-s. Mir ist schon bewusst, dass der eigentliche name auf die entsprechende straße zurückgeht, die sich nur mit ß schrieb. - Ich wollte das ganze nur noch einmal klar gestellt haben, es heißt ja immer, wir sollen uns an die quellen halten. Gruß--44Pinguine 13:49, 9. Apr. 2009 (CEST)
- Hallo 44Pinguine, zu der Schreibweise kann ich nichts sagen, an dieser Diskussion war ich nicht beteiligt. Zu Neu-Cölln: Das von Dir zitierte Werk ist in der Tat auch nach meinen Nachforschungen die Quelle dieses Irrtums. Dass es ein Irrtum ist, ist sonnenklar (siehe die amtliche Einteilung des Berlins von vor 1920 in Stadtteile sowie sämtliche historischen Fundstellen, zB Lexikaeinträge im Brockhaus oder Meyers von ca. 1910). Warum ein Ostberliner Verlag 1984 die alte Straßenbezeichnung des Märkischen Ufers als Stadtteilbezeichnung ins Spiel bringt, ist unklar. Möglicherweise ist es nur ein Irrtum, vielleicht steckt aber auch abstruse Angst dahinter, die Beziehung dieses Namens zum namensgleichen Westberliner Bezirk thematisieren zu müssen (oder sonstwas ideologisch verquastes). Wird man nicht abschließend klären können. Tatsache ist, dass es aus der Zeit vor dem von Dir genannten Buch von 1984 keinerlei Belege für einen Stadtteil "Neu-Cölln am Wasser" gibt; zumindest im Zentrum für Berlinstudien in der Breiten Straße [1] ist nichts dergleichen zu finden. Grüße-- Definitiv 14:23, 9. Apr. 2009 (CEST)
Ortslage Tiefwerder
[Quelltext bearbeiten]Hallo Definitiv. Ich lege demnächst einen gesonderten Artikel zu den Tiefwerder Wiesen mit Schwerpunkt Landschaftsschutzgebiet an. Im Zuge dessen baue ich wahrscheinlich den Artikel Tiefwerder aus beziehungsweise passe die beiden Artikel an. Das LSG hat seine Südgrenze eindeutig in der Heerstraße. Momentan ist mir die Südbegrenzung der ORTSLAGE Tiefwerder unklar. Mal ist zu lesen, Pichelswerder gehört dazu, mal nicht. Im WP-Artikel stand in dieser Version : Es besteht aus dem Waldgebiet des Pichelswerder, den Tiefwerder Wiesen und den .... Das hast Du in der nächsten Version geändert und aus dem vorher einbezogenen Pichelswerder die Südgrenze gemacht, wenn ich das richtig verstehe: Heute wird das gesamte Gebiet zwischen der Schulenburgstraße, der Havelchaussee, der Halbinsel Pichelswerder und der Havel als Tiefwerder bezeichnet. Da auch diese Darstellung Pichelswerder in die Ortslage einbezieht, blicke ich nicht mehr durch. Weißt Du Genaueres, Handfestes? Danke und Gruß --Lienhard Schulz Post 19:38, 14. Mai 2009 (CEST)
- Hallo Lienhard, das letzte richtig Handfeste ist die Situation von 1920. Da gab es die Gemeinde Tiefwerder mit 30 Hektar, die praktisch nur das bebaute eigentliche Dorf beiderseits der Dorfstraße umfasste. Ferner gab es den Gutsbezirk Pichelswerder mit 76 Hektar und 27 Einwohnern, der die gleichnamige Halbinsel umfasste; nach einer mir vorliegenden unscharfen Skizze der Verwaltungsgrenzen müsste das genau das heute noch durchgehend bewaldete Gebiet gewesen sein das bis zum Nordrand der Siedlung Brandensteinweg reicht. Dass die Siedlung am Brandensteinweg, auch Steffenhorn genannt, zu Pichelswerder gehörte, würde ich durch die Ansichtskarte und den Text auf [2]] als gesichert ansehen. Drittens gab es damals noch die Gemeinde Pichelsdorf mit 123 Hektar und 400 Einwohnern, die nach der mir vorliegenden Skizze offenbar das zwischen dem damaligen Tiefwerder und damaligen Pichelswerder gelegene Gebiet umfasste, was "Tiefwerder Wiesen" genannt wird. Alle drei genannten Gebiete waren durch Wasserläufe deutlich getrennt.
- Eine amtliche Untergliederung des Ortsteils Spandau gab es nach 1920 nicht. Neuerdings gibt es ein amtliches Gebiet "27 Tiefwerder" im neuen Regionalen Bezugssystem von Berlin, siehe Seite 17 dieses Dokuments: [3]. Zu diesem Gebiet gehört Pichelswerder sicherlich nicht, was man auch aus dem zugehörigen Adressverzeichnis erkennen kann:[4].
- In sämtlich mir bekannten Stadtplänen legt die Platzierung des Schriftzugs Tiefwerder ebenfalls nicht nahe, dass der Pichelswerder dazu gehört. Zu der von dir genannten Quelle www.tiefwerder.de: Die Jungs betreiben mit dem Namen ihrer Webseite einen schönen Etikettenschwindel. Die ganze Webseite handelt ausdrücklich von Neu-Venedig, und Neu-Venedig und Tiefwerder sind nicht dasselbe! Und wenn sie schreiben Es setzt sich zusammen aus dem Waldgebiet des Pichelswerder, den Tiefwerder Wiesen und den Freiheitswiesen. dann meinen sie natürlich Neu-Venedig. Mit anderen Worten:Eine sicher gut gemeinte, aber geographisch ziemlich konfuse private Webseite eines Interessenvereins. Mit dem eigentlichen Dorf Tiefwerder und dessen Bewohnern hat die Seite gar nichts zu tun! Auf dieser Webseite beruhte übrigens auch die von dir genannte alte Version von Tiefwerder; auch dort Überschrift Tiefwerder aber Inhalt Neu-Venedig.
- Aus der Tatsache dass das NSG namens Tiefwerder bis zur Heerstraße reicht, würde ich für die Abgrenzung des Gebiets Tiefwerder nicht unbedingt etwas ableiten; ich glaube auch nicht dass sich zB die Anwohner des Brandensteinwegs als zu Tiefwerder gehörend empfinden (kenne allerdings dort niemanden). Grüße -- Definitiv 22:06, 14. Mai 2009 (CEST)
- Ahh, das ist doch mal interessant und informativ. Dann würdest Du also die Ortslage nach Süden mit dem Kleinen Jürgengraben begrenzen? Das war eigentlich auch immer mein Eindruck aufgrund diverser Karten. Das heißt dann also, dass das LSG Tiefwerder Wiesen im Gegensatz zur Ortslage Tiefwerder auch einen Teil Pichelswerders einbezieht. Die Grenze dieser Nr. 27 verläuft jedenfalls deutlich entlang Kl. Jürgengraben/Hauptgraben. Gruß und herzlichen Dank --Lienhard Schulz Post 22:39, 14. Mai 2009 (CEST)
- Hallo Definitiv. Deine beiden Links (beide Seiten kannte ich noch nicht) sind große Klasse und werden mir noch bei vielen Artikeln helfen. Wenn das keine definitiv :-) „handfesten“ Angaben zu Berliner Ortslagen sind, dann weiß ich auch nicht. Weißt Du etwas zu „Schulzen-Wall“ und „Langer Wall“? Die sind auf der Karte des LSG Tiefwerder Wiesen in der Verlängerung des Hauptgrabens eingezeichnet (westlich parallel zum Hohlen Weg) und münden neben dem Hohlen Weg in den Stößensee. So lese ich es jedenfalls aus der Karte heraus, bin aber aufgrund der Platzierung der Schriftzüge und der Bezeichnung „Wall“ nicht 100 % sicher, ob tatsächlich die Gräben gemeint sind (wahrscheinlich schon, da mit „blauer“ Schrift eingetragen). Übrigens dürfte Deine Eintragung bei Pichelswerder (Jenseits des Grimnitzgrabens im Norden der Halbinsel schließen sich die Tiefwerder Wiesen an) nicht stimmen. Der „Grimnitzgraben“ liegt ziemlich sicher auf der anderen Havelseite und führt zum Grimnitzsee. Ich nehme an, Du meintest den „Kleinen Jürgengraben“. Gruß --Lienhard Schulz Post 09:18, 16. Mai 2009 (CEST)
Hallo Definitiv. Sorry, wenn ich erneut störe, aber ich arbeite hier nun mal gerade an Tiefwerder und habe noch eine Frage: Bist Du hinsichtlich der „Feuersbrunst“ ( ... nachdem durch eine Feuersbrunst am Spandauer Burgwall die dortigen Bewohner obdachlos geworden waren.) sicher? Wolfgang Ribbe beschreibt das lapidar ohne Feuersbrunst ungefähr so:
- Nach der Gründung der Mark Brandenburg durch den Askanier Albrecht der Bär 1157 und der danach einsetzenden mittelalterlichen Ostsiedlung wurde die slawische Bevölkerung des Spandauer Raums größtenteils von deutschen Zuwandereren assimiliert. Allerdings blieb eine Dienstsiedlung bei der Spandauer Burg mit slawischen Kietzern besetzt. Deren Nachkommen wurden ab 1815 nach Tiefwerder umgesiedelt
Und hier, Quelle von 1916 (in die Mitte scrollen) wird als Grund die Erweiterung der Festungswerke angegeben:
- ... Lynar - das alte Schloß zur Zitadelle ausgebaut wurde, mußten die Kietzer - ihre bisherige Wohnstätte verlassen und wurden am Pichelsdorfer - Wege angesiedelt, gegenüber dem "Burgwall", einer uralten Wendenschanze, von diesem durch einen schiffbaren Wasserarm getrennt. Auch von diesem "Neuen Kietz -" mußte jedoch die alte Fischergemeinde weichen, als Preußen im Jahre 1816 die Spandauer Festungswerke planmäßig erweiterte; sie erhielt eine neue Heimstätte auf dem Tiefwerder, einer langen, schmalen Insel zwischen der Havel und dem Faulen See, nördlich des Pichelswerders -. - Nachdem am 2. November 1815 die "Retablierung -" der Fischer hier durch die Ministerien genehmigt war, wurden diesen am 25. April 1816 die einzelnen Grundstücke zugewiesen. Die Bebauung erfolgte in den Jahren 1818 bis 1820 mit Unterstützung der Regierung.
Welche Quelle hattest Du? Danke und Gruß --Lienhard Schulz Post 19:26, 18. Mai 2009 (CEST)
- Hallo Lienhard, ich versuche mal, auf alles zu antworten:
- Danke für den Hinweis auf den Fehler mit dem Grimnitzgraben, ich habe Pichelswerder entsprechend korrigiert
- und dort einen Weblink eingefügt, der dich auch interessieren wird (mehrere Karten von Pichelswerder)
- ja, die eigentliche Ortslage Tiefwerder wird offenbar durch den Kleinen Jürgengraben im Süden begrenzt und die Tiefwerder Wiesen liegen südlich dieses Grabens. Insofern ist die jetzige Darstellung in Tiefwerder wohl etwas unexakt...
- Bei der Verwendung der "Lebensweltlich Orientierten Räumen" in der WP wäre ich vorsichtig; als Indizien sicher wertvoll, man kann da aber schnell in Teufels Küche kommen, denn die LOR-Gebietshierarchie ist nicht kompatibel zu den Ortsteilen. Beispiel: Die „Bezirksregionen“ Schöneberg-Nord plus Schöneberg-Süd ergeben keineswegs den Ortsteil Schöneberg und die Bezirksregion Friedenau ist größer als der Ortsteil Friedenau. Nicht vergessen, da hat jemand vom Senat den Auftrag bekommen, Stadtviertel nach der Lebenswirklichkeit einzuteilen und dann in bester Absicht Grenzen in einen Stadtplan gezeichnet und die dann entstandenen Untergliederungen mehr oder weniger sinnvoll benannt! (Achtung, Theoriefindungsgefahr!)
- zu Besiedlung Tiefwerder habe ich zwei Fundstellen: a) [5] und b) den folgenden Eintrag aus dem "Berlin-Handbuch", FAB Verlag 1993 (der dicke blaue Wälzer): Tiefwerder...entstand als Neugründung für die Bewohner der 1813 abgebrannten Siedlung Kietz und der Häuser am Burgwall. Deine Quellen klingen für mich glaubwürdiger, d.h. hier besteht wohl in der Tat noch Klärungs- und ggf Korrekturbedarf!
- Bezeichnet Wall nicht im Berliner Raum Inseln? Zu „Schulzen-Wall“ und „Langer Wall“ finde ich aber bisher auch nichts. Grüße -- Definitiv 22:35, 18. Mai 2009 (CEST)
- Hallo Lienhard, ich versuche mal, auf alles zu antworten:
- Hallo Definitiv. Die Pichelsdorf-Karten, und auch die Bilder, sind fürwahr interessant. Na ja, so ganz ohne ist Deine Quelle zur „Feuersbrunst“ auch nicht. Wahrscheinlich gebe ich einfach beide Versionen im Artikel wieder. Ribbe gibt als seine Quelle an: Otto Kuntzenmüller, Urkundliche Geschichte der Stadt und Festung Spandau von der Entstehung der Stadt bis zur Gegenwart, Spandau 1881, S. 254-256. Vielleicht schau ich in den historischen Schinken mal rein. Der sollte im Zentrum für Berlin-Studien und/oder in Spandau verfügbar sein. So ein Mist. Ich dachte, mit dem LOR-System könnten wir den gordischen Berliner Ortslagen-Grenzenknoten ein für alle Mal durchschlagen. Gut, dass Du nochmal gewarnt hast. Die West-, Süd- und Ostgrenze der Ortslage Tiefwerder dürfte klar sein. Zweifelhaft bleibt die Nordgrenze. Lass uns bitte mal gemeinsam versuchen, hierzu eine hinreichend plausible Festlegung zu treffen.
- Die jetzige („Deine“) Definition zieht die Nordgrenze mit der Schulenburgstraße.
- Die Ortsteilgrenze von Wilhelmstadt verläuft eindeutig ein kleines Stück nördlicher und bezieht die Nordostecke Teltower Str./Elsgrabenweg/Charlottenburger Chausse mit ein. Eindeutig, weil so im ADAC-Stadtatlas Band 16 enthalten, der sich hinsichtlich der Orsteilgrenzen bislang als zuverlässig erwiesen hat.
- LOR bezieht diese Nordostecke in die Ortslage Tiefwerder ein.
- Wenn das nicht stimmt, ergibt sich die Frage, zu welchem Ortsteil diese Nordostecke dann gehört. In Frage kommen Ruhleben, Spandau, zur Not Stresow. Damit müsste dann logischerweise Wilhelmstadt Anteil entweder an Ruhleben, Stresow oder Spandau haben, was ich noch nie gehört habe, was aber auch nicht auszuschließen ist.
- Weiteres Problem:
- Die Jungs von LOR beziehen auch die Nordwestecke oberhalb der Schulenburgstraße bis zu Ruhlebener Straße (Dischinger Brücke) in ihren Raum 27 = Tiefwerder ein. So z.B. „Am Osthafen“. Über die noch darüberliegenden Gellertweg, Schillerweg und Heinweg schweigen sie sich im Adressverzeichnis zwar aus, laut Karte aber klar mit drin.
- Dieses Gebiet dürfte nun 10x eher dem Stresow als Tiefwerder zuzuordnen sein, sodass Du mit Deiner Warnung vor den fröhlichen Kartenzeichnern sicher Recht hast.
- Das Problem erscheint natürlich recht bedeutungslos. Dämlicherweise liegen in der Nordostecke Baudenkmäler wie Mietshäuser und die Teltower Schanze. Gehören sie zu Tiefwerder, beschreibe ich sie mit. Wenn nicht, gehören sie da nicht rein. Was also tun, wohin mit der Nordostecke? Gruß --Lienhard Schulz Post 12:31, 19. Mai 2009 (CEST)
- Hallo Lienhard, nach meinen Unterlagen (recht ungenaue Karten) gehörte die von dir beschriebene Nordostecke zum Landkreis Teltow (Tiefwerder gehörte zum Landkreis Osthavelland). Innerhalb des Landkreises gehörte das Gebiet demnach zum Gutsbezirk Grunewald-Forst bzw ab 1914 zum Gutsbezirk Heerstraße. Dieser wurde 1920 (siehe Groß-Berlin-Gesetz) zwischen Spandau und Charlottenburg geteilt, unser Gebiet hier kam zu Spandau. Ruhleben war nie eine politische Einheit, aber die Gebietsbezeichnung für den Norden des Gutsbezirks Heerstraße und wurde somit 1920 auf zwei Bezirke aufgeteilt. Siehe auch die Karte des Kreises Teltow Bei genauem Hinsehen kann man auch hier [6] und hier [7] die Kreisgrenze erkennen/erahnen Grüße -- Definitiv 19:43, 19. Mai 2009 (CEST)
- PS:Hab noch eine schöne Karte gefunden: [8]
- Das Problem erscheint natürlich recht bedeutungslos. Dämlicherweise liegen in der Nordostecke Baudenkmäler wie Mietshäuser und die Teltower Schanze. Gehören sie zu Tiefwerder, beschreibe ich sie mit. Wenn nicht, gehören sie da nicht rein. Was also tun, wohin mit der Nordostecke? Gruß --Lienhard Schulz Post 12:31, 19. Mai 2009 (CEST)
Die Karte ist Klasse. Sie zeigt sehr schön die „ursprüngliche“ (?) Struktur des Gebiets. Und weckt nochmal Zweifel an unseren heutigen Definitionen. Denn man kann davon ausgehen, dass der Flurname „tiefer Werder“ seinen Namen in Abgrenzung zum hochgelegenen Pichelswerder erhielt (die Höhe des Pichelswerder wird dem Teltow zugerechnet - ist belegbar). Dann legt die Karte nahe, dass als Pichelswerder ursprünglich lediglich der Teil südlich der Heerstraße + der östliche Teil nördlich der Heerstraße (Dein Brandensteinweg von oben, in dem Du dämlicherweise Niemanden kennst) bezeichnet wurde. Und das ganze Niederungsgebiet, das hier wunderbar eingezeichnet ist, der Tiefwerder war (inclusive der Niederung südlich vom Jürgengraben, die wir heute Pichelswerder zuordnen). Von unserer heutigen Grenze zwischen Tiefwerder und dem Pichelswerder, dem Jürgengraben, ist auf der Karte noch nicht viel zu sehen, jedenfalls fehlt das Stück zu Havel. Vielleicht begrenzt der Jürgengraben auch heute noch lediglich die Ortslage Tiefwerder nach Süden, aber nicht den Werder als Flur. Rätsel über Rätsel. Ich sag Dir: Wenn wir mit Tiefwerder durch sind, veröffentlichen wir das „richtig“ und „schinden damit richtig Eindruck“ :-), dem gelassenen Alter zum Trotz. Einen Ausschnitt der Karte baue ich in den Artikel ein. Dank auch für die vorstehenden Hinweise.
Zu der „Feuersbrunst“ etc. hat sich übrigens inzwischen ergeben: beides ist richtig, das waren unterschiedliche Zeiten. Vom Spandauer Kietz bei Zitadellenausbau um 1560 auf den Burgwall und dann nach einem dortigen Brand nach Tiefwerder, siehst Du dann, irgendwann, im Artikel. Gruß --Lienhard Schulz Post 15:24, 20. Mai 2009 (CEST)
- Schau bitte trotz Werder (ohne Diego) nochmal auf "unseren" Werder (Kapitel 1.1 und 1.2, alles neu). Allmählich müsste es hinkommen. Den Gutsbezirk Heerstraße etc. habe ich eingearbeitet. Noch Fehler, Unsinn drin? Gruß --Lienhard Schulz Post 19:35, 20. Mai 2009 (CEST)
- bitte noch etwas Geduld, hab heute keine Zeit -- Definitiv 23:18, 25. Mai 2009 (CEST)
- Lass Dir Zeit. Nach etwas Abstand zum Text denke ich eh, dass das Ganze so Mist ist. Zu lang, zu kleinteilig, verständlich allenfalls für Berliner. Ich werde das also die Tage wahrscheinlich nochmal radikal kürzen und umschreiben. Gruß --Lienhard Schulz Post 06:10, 26. Mai 2009 (CEST)
- Ok, hier ein paar (rein subjektive) Bemerkungen zum aktuellen Stand:
- Lass Dir Zeit. Nach etwas Abstand zum Text denke ich eh, dass das Ganze so Mist ist. Zu lang, zu kleinteilig, verständlich allenfalls für Berliner. Ich werde das also die Tage wahrscheinlich nochmal radikal kürzen und umschreiben. Gruß --Lienhard Schulz Post 06:10, 26. Mai 2009 (CEST)
- So wie in der Einleitung formuliert, klingt es als ob das Ballhaus schon immer (also auch schon in den 1920ern) eine Diskothek war!?
- Ist der Tote Mantel teilweise natürlich verlandet oder künstlich zugeschüttet worden?
- statt S-Bahn Wall besser S-Bahn-Wall oder S-Bahn-Damm oder S-Bahndamm
- typo Teltowplateau
- Die Tiefwerder Wiesen .... enthalten Feuchtwiesen
- eine Quelle für kleinteilige aktuelle Einwohnerzahlen ist mir leider auch nicht bekannt
- aber für Wahlergebnisse: Bei Wahlen in Berlin bildet der Stimmbezirk 303 ziemlich gut Tiefwerder ab; siehe Ergebnisse, Beschreibung und Karte des Stimmbezirks 303 in [9]. Das Wahlverhalten scheint aber nicht allzuweit entfernt vom Spandauer Durchschnitt zu liegen.
- insgesamt eine umfassende und objektive Darstellung; eine stellenweise Straffung ist vielleicht noch sinnvoll
- vielleicht noch, wenn es lizenzrechtlich geht, einen Ausschnitt aus [10] einbauen?
Weiterhin gutes Gelingen und Grüße -- Definitiv 18:38, 27. Mai 2009 (CEST)
- Die Karte habe ich als public domain hochgeladen. Das sollte bei einem Werk von 1836 eigentlich hinhauen. Die Wahlen 2006 und Deine Tipps habe ich verbraten (putzigerweise deckt sich der Stimmbezirk 303 fast genau mit der LOR-Kartierung abzüglich Stresow-Ecke ... also fast identisch mit der hier entwickelten Beschreibung). Deine Frage zum Toten Mantel kann ich nicht beantworten; aus der Anschauung vor Ort und diverser Karten halte ich eine natürliche Verlandung für wahrscheinlicher. Im Artikel ist der Tote Mantel eh meinen Streichungen zum Opfer gefallen; es sollte reichen, wenn er im LSG-Artikel auftaucht. Danke für die Hilfen und Gruß --Lienhard Schulz Post 19:07, 28. Mai 2009 (CEST)
Kreise in Hannover
[Quelltext bearbeiten]Schön, dass Du alle Lücken geschlossen hast, und jetzt alle Kreise der Provinz vollzählig sind! Eine kurze Frage: bei Kreis Neuhaus an der Oste habe ich die Bevölkerungsdichte nicht gefunden. Steht die in einer von Dir benutzten Quelle? Beste Grüße, --CWitte ℵ1 13:12, 26. Jun. 2009 (CEST)
- Wenn man [11] Glauben schenkt (und das kann man, denke ich), dann stimmte die Fläche in der Infobox von Kreis Neuhaus an der Oste sowieso nicht. Ich habe das mal entsprechend angepasst und auf der Grundlage dann die Bevölkerungsdichte einfach selber ausgerechnet (alles für 1910). Grüße-- Definitiv 14:49, 26. Jun. 2009 (CEST)
- Sehr schön. Woher hatte ich denn die falsche Fläche? Ohgott: die hatte ich in der Tabelle gelassen, sehe ich gerade (Zahl gehört zu Zeven!). Ich hatte ja keine Fläche gefunden, sonst hätte ich das natürlich auch ausgerechnet. Die Zahl der Gemeinden, die ich eingetragen hatte war von 1927. Da scheinen also schon einige zusammengelegt worden zu sein.--CWitte ℵ1 15:09, 26. Jun. 2009 (CEST)
Daß/Dass
[Quelltext bearbeiten]Hallo Definitiv. Vielen Dank. Bitte, setz' mich auf Deine Beobachtungsliste, wenn Du willst, denn da kommst Du mit dem ß immer auf Deine Kosten. Auch andere habe ich darum schon gebeten. Ich bin nicht die Generation, die diese Geschichten mitmacht. Der Verlag, wo hin und wieder etwas von mir erscheint, oder die Redaktionen von Zeitschriften korrigieren fast immer automatisch - nicht immer :-) Gruß --Orientalist 16:54, 12. Aug. 2009 (CEST)
- Och, mir ist da jede missionarische Gesinnung fremd. Es fehlt mir andererseits leider aber auch jedwede Larmoyanz bezüglich der vielen Neuerungen, die meine gebeutelte Generation erdulden muss (Rechtschreibreform, Abschaltung des analogen Fernsehens, Dominanz von Werksmannschaften in der Bundesliga usf.). Grüße -- Definitiv 16:02, 27. Aug. 2009 (CEST)
Reichstagsabgeordnetenlisten
[Quelltext bearbeiten]Hi Definitiv, du hast mit großem Fleiß die Artikel zu den Reichstagswahlen um die Abgeordnetenlisten ergänzt. Danke für deine Arbeit! Was mir aber aufgefallen ist: du hast vielfach den zweiten Vornamen weggelassen, wohl in der irrigen Annahme, dass der erste Vorname automatisch der Rufname gewesen sein müsste. Zumindest für Sachsen kann ich sagen, dass meist der zweite Vorname Rufname war. Das bedarf aber sicher immer einer Einzelfallbetrachtung und solange aus keiner zuverlässigen Quelle der Rufname eindeutig hervorgeht, gehören m.E. die vollständigen Vornamen in das Lemma. Ich hab da gestern zumindest für das KR Sachsen schon mal bissel was gefixt, aber vielleicht kannste den Sachverhalt ja auch selbst nochmal abprüfen... Viele Grüße -- Miebner 13:58, 3. Jan. 2010 (CET)
- Ja, Danke für den Hinweis. Aus den Quellen (hier üblicherweise Reichstagshandbücher oder Reichstagsprotokolle) ist leider nur selten zu erkennen, welcher der manchmal recht vielen Vornamen der damalige Rufname war. Letztlich sind wir hier auf die Mitarbeit möglichst vieler WPler mit lokalem historischen Wissen angewiesen. Die korrekte Benennung von "roten" Lemmata ist ein bisschen knifflig; ich sehe gerade dass die WP-Richtlinien sagen Falls es sich um eine relativ unbekannte Person handelt, deren Lebenszeit und die damit zusammenhängenden Benennungskonventionen lange zurück liegen und/oder schwer nachvollziehbar sind, können die ersten (beiden) Vornamen als Rufname angesehen werden. Etwas schwammig, ob damit gemeint ist, dass der Lemmaname maximal zwei Vornamen enthalten darf, ist mir nicht ganz klar. Man landet dann uU schnell bei einem verunglückten Lemmanamen wie Carl Franz Wilhelm Edel. Aber egal - ich werd mich bemühen! Grüße -- Definitiv 10:24, 14. Jan. 2010 (CET)
Hallo Definitiv,
in den Artikeln zu den Wahlen zum Reichstag des Norddeutschen Bundes (1867 I und II) sind die Bezeichnungen, die Du für die Wahlkreise in Mecklenburg-Schwerin verwendet hast (u.a. Kammergüter) merkwürdig bzw. nicht nachvollziehbar. Sie weichen von den im Artikel zur Reichtagswahl 1871 verwendeten ab und zeigen die territoriale Ausdehnung der Wahlkreise nicht an. Hast Du dafür eine Quelle/Erklärung? Danke schon mal für die Aufklärung. LG Bernsteinkater (Diskussion) 12:52, 7. Apr. 2015 (CEST)
- Hallo, ja, in der Tat, im Gegensatz zu allen anderen Bundesstaaten gab es 1867 und 1871 in Mecklenburg-Schwerin zwar gleich viele aber ansonsten verschiedene Wahlkreise:
- Gruß --Definitiv (Diskussion) 13:11, 7. Apr. 2015 (CEST)
Moabit kann man trockenen Fußes auf dem Landweg nur über eine Brücke oder mit der U-Bahn erreichen, warum also soll die Kategorie unsinnig sein? --Komischn 22:00, 12. Mai 2010 (CEST)
- Weil das keine hinreichenden Fakten für eine Klassifizierung als Insel sind. Was eine Insel ist, ist hier beschrieben. Durch künstliche Bauwerke (Kanäle) abgeschnittene Flächen sind keine Inseln. Wenn Moabit eine Insel wäre, stände es auch in der Liste deutscher Binneninseln, tut es aber nicht. Wenn Moabit eine Insel wäre, wäre zB auch das von Spree, Landwehrkanal, Havel und Teltowkanal umschlossene und nur über Brücken zugängliche Gebiet eine Insel. Jede Menge solche weitere Beispiele wären möglich. Grüße -- Definitiv 14:46, 13. Mai 2010 (CEST)
- Finde in der Definintion von Insel nichts, was gegen Moabit sprechen würde. Ein Kanal ist ein Binnengewässer. Sollte Moabit keine Insel sein, ist an dem Artikel nicht nur die Kategorisierung verkehrt. Grüße, --Komischn 15:18, 13. Mai 2010 (CEST)
- In der Tat, auch die dortige Bezeichnung von Moabit als "Künstlicher Insel" passt nicht zur WP-Definition einer künstlichen Insel. Es fehlt im Artikel Moabit übrigens der Hinweis, die wievieltgrößte Insel Berlins oder Deutschlands Moabit ist. Die entsprechende Information sollte doch zu beschaffen sein! Die Tatsache, dass Charlottenburg am Neuen Ufer in Höhe Sickingenstraße über den Verbindungskanal nach Osten hinüberreicht, könnte man außerdem auch noch für die Aufnahme einer Insel Charloabit in die Kategorie:Geteilte Insel nutzen. Nur zu! Grüße -- Definitiv 15:42, 13. Mai 2010 (CEST)
- Finde in der Definintion von Insel nichts, was gegen Moabit sprechen würde. Ein Kanal ist ein Binnengewässer. Sollte Moabit keine Insel sein, ist an dem Artikel nicht nur die Kategorisierung verkehrt. Grüße, --Komischn 15:18, 13. Mai 2010 (CEST)
Deine unsinnigen Reverts zur Seestraße
[Quelltext bearbeiten]Möchtest Du Dich nicht einfach mal informieren statt Artikel zu zerstören? Es gab 1962 ein großangelegtes Programm zur "Modernisierung" von Hausfassaden auf der Besuchstrecke fon Kennedy. --Schily 12:37, 13. Aug. 2010 (CEST)
- Dann wird dieses Programm sicherlich irgendwo im WWW erwähnt werden und darf dann gerne fon Dir verlinkt werden. Dass in diesem Zusammenhang sämtliche Häuserfronten der Seestraße behandelt wurden, widerspricht jeder Lebenserfahrung. Gruß --Definitiv 12:40, 13. Aug. 2010 (CEST)
- Du hast gerade belegt, daß Du die Seestraße nicht kennst, in der ganzen Seestraße haben nicht mehr als drei Häuser ihre Stuckfassade nach dem Kennedy-Besuch behalten können. Ddamit ist ja aber wohl klar, daß meine Ergännzung bleibt. --Schily 12:42, 13. Aug. 2010 (CEST)
- Trotz deiner schlüssigen Argumentation und Beweisführung bleiben allerdings gewisse Restzweifel. Na ja, Restzweifel ist untertrieben. Eigentlich glaube ich, du erzählst einfach nur ganz großen Quatsch. Gruß --Definitiv 12:47, 13. Aug. 2010 (CEST)
- Du hast gerade belegt, daß Du die Seestraße nicht kennst, in der ganzen Seestraße haben nicht mehr als drei Häuser ihre Stuckfassade nach dem Kennedy-Besuch behalten können. Ddamit ist ja aber wohl klar, daß meine Ergännzung bleibt. --Schily 12:42, 13. Aug. 2010 (CEST)
Palais Hardenberg
[Quelltext bearbeiten]Hallo Definitiv, du hast in dem Artikel ergänzt, dass der Reichstag des Norddeutschen Bundes von 1867 bis 1870 im Palais Hardenberg tagte. Hast du dafür einen Beleg? Ich habe einer Quelle (Berlin-Archiv, Sammelblatt 05133) entnommen, dass der Reichstag des Norddeutschen Bundes in dieser Zeit in der Leipziger Straße 3 tagte.--Schibo 17:42, 21. Aug. 2010 (CEST)
- Folgenden Beleg habe ich auf die Schnelle gefunden: http://www.bundestag.de/blickpunkt/104_Spezial/0803/0803006.htm ; ich werde der Sache aber nochmal nachgehen, an deinem Einwand könnte etwas dran sein. Unbestrittene Fakten sind zunächst, dass das Preußische Abgeordnetenhaus im Palais Hardenberg am Dönhoffplatz tagte und das Preußische Herrenhaus an der Leipziger Straße 3. Beide zusammen bildeten den Preußischen Landtag. Fakt ist auch, dass der 1871er Reichstag des Kaiserreichs zunächst von März bis Oktober 1871 im Palais Hardenberg tagte und dann in einen Neubau an der Leipziger Straße 4 neben dem Herrenhaus umzog, siehe [12] Dies alles war möglicherweise die Ursache mancher Konfusion die man sowohl im WWW als auch in der WP findet. Gruß --Definitiv 13:09, 22. Aug. 2010 (CEST)
- Einen Saalplan des RT des NDB haben wir hier schon mal. Jetzt müssen wir bloß noch klären, in welchem Haus sich dieser Saal befand.--Definitiv 14:34, 22. Aug. 2010 (CEST)
- Hallo Definitiv, unter bundestag.de habe ich zwei Belege mit anderslautender Aussage gefunden, die meinen ersten Hinweis stützen, und zwar unter http://www.bundestag.de/kulturundgeschichte/geschichte/schauplaetze/leipzigerstrasse/index.html und http://www.bundestag.de/blickpunkt/105_Unter_der_Kuppel/0403016.html Gruß --Schibo 17:33, 23. Aug. 2010 (CEST)
- Ja, ich bin jetzt auch überzeugt dass Du Recht hast. Zum einen erscheint mir das hier sehr glaubhaft, und auch der Saalplan beweist es indirekt. Der Saal hatte ca 280 Plätze - also konnte da nicht das preußische Abgeordnetenhaus mit seinen 350 Abgeordneten reinpassen, also handelt es sich um den Saal des Herrenhauses. Habs korrigiert.Danke für deine Hinweise & Gruß --Definitiv 18:49, 23. Aug. 2010 (CEST)
- Hallo Definitiv, unter bundestag.de habe ich zwei Belege mit anderslautender Aussage gefunden, die meinen ersten Hinweis stützen, und zwar unter http://www.bundestag.de/kulturundgeschichte/geschichte/schauplaetze/leipzigerstrasse/index.html und http://www.bundestag.de/blickpunkt/105_Unter_der_Kuppel/0403016.html Gruß --Schibo 17:33, 23. Aug. 2010 (CEST)
Danke für die Korrektur, die Grenze verläuft nordöstlich. In manchen Quellen steht halt Radrennbahn in Bielefeld-Heepen, da hatte ich das als Ortsunkundige übernommen. Aber da wurden wohl Ortsteil und Straße miteinander verwechselt. --Nicola Verbessern statt löschen! 12:07, 22. Sep. 2010 (CEST)
- Gerne, außerdem Danke für den schönen Artikel. Ich meine mich erinnern zu können, dass der Innenraum der Radrennbahn früher auch die Haupt-Trainingstätte von Arminia Bielefeld war und dass dort auch schon Rockkonzerte oder- festivals stattgefunden haben. Wenn ich da noch was konkretes und belegbares finde, werd ich es auch in den Artikel einbauen. Gruß-- Definitiv 12:47, 22. Sep. 2010 (CEST)
- Gern geschehen ;) Ja, solche Infos wären noch schön. Ich bin auch noch nicht ganz zufrieden, denn eigentlich muss ja in 50 Jahren mehr radsportlich Erwähnenswertes passiert sein (dass Andy Kappes da mal gestürzt ist, ist nicht wirklich spektakulär). Und die genauen Zahlen bzgl. DM muss ich noch herausfinden. Dir noch einen schönen Tag, --Nicola Verbessern statt löschen! 12:53, 22. Sep. 2010 (CEST)
Lass dich feiern. Doc Taxon hat mir heute die Kopie aus dem Buch "Die konservativen Abgeordneten des deutschen Reichstags" geschickt, womit ich den Artikel Max Wildgrube schreiben konnte und wir euch endlich feiern können. Ohne eure Mammutarbeit hätte es wohl wesentlich länger gedauert. Grüße--Ticketautomat 17:25, 28. Okt. 2010 (CEST)
- Danke, aber mein Beitrag (ich glaube etwa 35 Artikel) ist gegenüber der Herkules-Leistung vom Kollegen Pfalzcondor eher bescheiden. Gruß -- Definitiv 20:39, 28. Okt. 2010 (CEST)
- 35 Artikel sind 35 Artikel, auch dafür muss man sich mal ein Danke anhören. Grüße--Ticketautomat 21:06, 28. Okt. 2010 (CEST)
Umkategorisierung von Orten
[Quelltext bearbeiten]

Hallo, Definitiv! Ich bin hier zwar nicht übermäßig aktiv und habe zugegebenermaßen zwar keine Ahnung, wo das Schema besprochen wurde, ehemals eigenständige Orte (bis 1974) in die neuen Kreise (ab 1975) einzutragen, siehe z.B. [13] oder [14], aber ich halte es für keine gute Idee, alt und neu auf diese Weise zu vermischen, weil ich so beispielsweise (wenn ich's nicht besser gewusst hätte) sonst zunächst geglaubt hätte, als ehemalige Gemeinde wäre Herbern Teil des Kreises Coesfeld gewesen (und nicht des Kreises Lüdighausen) und Hollen Teil des Kreises Gütersloh (und nicht des Kreises Bielefeld). Zumindest fände ich es schade, wenn die Informationen über die Zugehörigkeit zu den alten Kreisen auf die Dauer verlorengehen würden. Viele Grüße --Angela H. 10:34, 13. Dez. 2010 (CET)
- Hallo Angela, wie es zu diesem Schema gekommen ist lies bitte hier. Ich persönlich befürworte dieses Schema ausdrücklich. Informationen gehen eigentlich nicht verloren, siehe Erwähnung von Hollen in Landkreis Bielefeld und in Amt Isselhorst und in Amt Brackwede. Das von dir befürwortete Schema läuft immer in logische Sackgassen, schau mal wie oft zB Gellershagen in diesem Jahr schon re-kategorisiert worden ist. Dieser Zirkus wäre sonst endlos weitergegangen. Viele Grüße -- Definitiv 10:55, 13. Dez. 2010 (CET)
- Hallo, nochmal! Ohje, ich vergesse immer, dass es auch die „Links auf diese Seite“ gibt, die an manchen Stellen nützlich sind… Mir ist eben gerade noch aufgefallen, dass einiges nach diesem Schema beim als ehemalige Gemeinde beim Kreis Minden verlinkt ist, aber dann hier natürlich auch der Kreis Minden-Lübbecke stehen müsste. Hat sich da jemand vertan, oder seid Ihr „Umkategorisierer“ noch nicht soweit? Viele Grüße --Angela H. 12:02, 13. Dez. 2010 (CET)
- Abwarten, Ruhe bewahren, Tee trinken, Kategorie:Ehemalige Gemeinde in Nordrhein-Westfalen minütlich aktualisieren und andere Leute bei der Arbeit bestaunen ;-) -- Definitiv 12:08, 13. Dez. 2010 (CET)
- Na gut, dann bestaune ich hiermit mal alle… Viele Grüße --Angela H. 12:31, 13. Dez. 2010 (CET) P.S.: Habe auch noch ein wenig Tee und Kuchen mitgebracht (für einen der Fleißigen), wobei ich hoffe, das der Tee und der Kuchen für alle Beteiligten reicht.
- Abwarten, Ruhe bewahren, Tee trinken, Kategorie:Ehemalige Gemeinde in Nordrhein-Westfalen minütlich aktualisieren und andere Leute bei der Arbeit bestaunen ;-) -- Definitiv 12:08, 13. Dez. 2010 (CET)
- Hallo, nochmal! Ohje, ich vergesse immer, dass es auch die „Links auf diese Seite“ gibt, die an manchen Stellen nützlich sind… Mir ist eben gerade noch aufgefallen, dass einiges nach diesem Schema beim als ehemalige Gemeinde beim Kreis Minden verlinkt ist, aber dann hier natürlich auch der Kreis Minden-Lübbecke stehen müsste. Hat sich da jemand vertan, oder seid Ihr „Umkategorisierer“ noch nicht soweit? Viele Grüße --Angela H. 12:02, 13. Dez. 2010 (CET)
Kategorie Ehemalige Gemeinde in HH
[Quelltext bearbeiten]Moin. Ich sehe mit Unverständnis Deine Kat-Ergänzungen bzw. -Änderungen in den Vororten der ehemaligen Stadt Altona. Klein Flottbek bspw. war vorher eine Gemeinde im holsteinischen Landkreis Pinneberg, verlor mit der Eingemeindung nach Altona diesen Status (natürlich) – und war auch ab 1937/38, ab dann in Hamburg, keine eigenständige Gemeinde mehr. Von daher vermittelt diese Kategorisierung eine sachlich falsche Information, und selbst, wenn das Kat-Projekt das so beschlossen haben sollte, bleibt es falsch. Gruß von -- Wwwurm Mien Klönschnack 22:55, 14. Dez. 2010 (CET)
- Warum erzählst Du das mir und nicht dem Kat-Projekt, wo das ellenlang diskutiert worden ist? Klein-Flottbek ist eine ehemalige Gemeinde auf dem Gebiet des jetzigen Landes Hamburg und die Kategorie:Ehemalige Gemeinde in Deutschland ist nach den 16 aktuellen Bundesländern (und nicht nach früheren preußischen Provinzen) gegliedert. Wo Problem? Gruß -- Definitiv 23:08, 14. Dez. 2010 (CET)
- Dir „erzähle“ ich das, weil ich gesehen habe, dass Du das in den Artikeln geändert hast. Da bist ganz selbstverständlich Du mein erster Ansprechpartner.
- „Problem?“ Ja, Problem. Anscheinend ist diese Kategorie einfach falsch benannt, weil sie einen irrigen Eindruck im Artikel erweckt. Kategorie:Ehemals selbständige holsteinische Gemeinde in Hamburg bspw. wäre zwar sperriger, aber nicht so falsch. Welcher Normalleser liest schon Kategorieerklärungsseiten? -- Wwwurm Mien Klönschnack 23:21, 14. Dez. 2010 (CET)
- Moment mal. Mag ja sein, dass diese Gliederung nach Bundesländern durchgeführt ist, aber auch dann sind Altona usw. keine ehemaligen Gemeinden in Hamburg. Das Bundesland gibt es erst seit 1948(?) und da waren Altona&Co. schon lange eingemeindet. Fakt ist Altona usw. waren Gemeinden in der ehemaligen preußischen Provinz in Schleswig-Holstein. Also entweder eine entsprechende Kategorie verwenden oder Provinz und Bundesland für die Kategorie gleichsetzen. (Ich bin für letzteres, das dies in S.-H. nicht kompliziert ist.) Aber nicht "Ehem. Gemeinde in Hamburg". -- Ohauahauaha 07:53, 15. Dez. 2010 (CET)
- Nur eine kleine Korrektur: Altona selbst war durchaus, wenn auch kurzzeitig (April 1937 bis März 1938) eine selbständige Stadt im Land Hamburg. -- Wwwurm Mien Klönschnack 09:28, 15. Dez. 2010 (CET)
- Auch wie von dir vorgeschlagen könnte man verfahren. Es entspricht aber nicht dem Schema, worauf man sich momentan diesbezüglich geeinigt hat, gerade wegen der vor dem Krieg in einer anderen Länderstruktur eingemeindeten Gemeinden. Richtest Du für Harburg eine Unterkat Kategorie:Ehemalige Gemeinde in der Provinz Hannover ein oder setzt du Niedersachsen mit der Provinz Hannover gleich und packst Harburg nach Niedersachsen? Gleiche Frage für Rüstringen (Stadt). Gruß-- Definitiv 08:33, 15. Dez. 2010 (CET)
- Ist mir völlig egal was mit Harburg und Rüstringen passiert. Bei Schleswig-Holstein habe ich es vielleicht etwas einfacher, da Provinz und Bundesland weitestgehend identisch. Es gibt aber tatsächlich eine Unterkategorie für die 1920 an Dänemark abgetretenen Gemeinden, u.a. auch weil es so viele sind. --Ohauahauaha 09:24, 15. Dez. 2010 (CET)
- Prima Einstellung, Leute wie dich brauchen wir hier. Gemeinden aus Nordschleswig haben übrigens im Katbaum Kategorie:Ehemalige Gemeinde in Deutschland nichts zu suchen, genauso wenig wie die aus Elsaß-Lothringen oder Oberschlesien.-- Definitiv 09:31, 15. Dez. 2010 (CET). -- Definitiv 09:31, 15. Dez. 2010 (CET)
- Weshalb so dünnhäutig, wenn's um Sinn oder Unsinn einer Kat geht? Ich habe jetzt Kategorie:Ehemals holsteinische Gemeinde in Hamburg als Unterkat angelegt. Scheint mir die einfachste der korrekten Lösungen zu sein. Und ja, auch eine weitere Unterkat à la Kategorie:Ehemals hannöversche Gemeinde in Hamburg wäre sinnvoll. -- Wwwurm Mien Klönschnack 09:59, 15. Dez. 2010 (CET)
- Warum bitte schön haben ehemalige Gemeinden aus Nordschleswig dort nichts zu suchen? --Ohauahauaha 14:20, 15. Dez. 2010 (CET)
- Weil mit "Deutschland" im Dachkategorienamen Ehemalige Gemeinden in Deutschland die Bundesrepublik in den Grenzen von heute morgen gemeint ist und nicht das Deutsche Reich in den Grenzen von 1917. Dies wiederum folgt aus der zugehörigen Kategoriebeschreibung und dem dortigen Wikilink Deutschland.-- Definitiv 15:08, 15. Dez. 2010 (CET)
- Na wenn da so ist, dann gehört auch Altona nicht in diese Kategorie. Schließlich war Altona nie eine Gemeinde in der Bundesrepublik. --Ohauahauaha 12:56, 16. Dez. 2010 (CET)
- Zugegebenermaßen ist die Kat-Beschreibung diesbezüglich sprachlich etwas unscharf. -- Definitiv 13:51, 16. Dez. 2010 (CET)
- Na wenn da so ist, dann gehört auch Altona nicht in diese Kategorie. Schließlich war Altona nie eine Gemeinde in der Bundesrepublik. --Ohauahauaha 12:56, 16. Dez. 2010 (CET)
- Weil mit "Deutschland" im Dachkategorienamen Ehemalige Gemeinden in Deutschland die Bundesrepublik in den Grenzen von heute morgen gemeint ist und nicht das Deutsche Reich in den Grenzen von 1917. Dies wiederum folgt aus der zugehörigen Kategoriebeschreibung und dem dortigen Wikilink Deutschland.-- Definitiv 15:08, 15. Dez. 2010 (CET)
- Warum bitte schön haben ehemalige Gemeinden aus Nordschleswig dort nichts zu suchen? --Ohauahauaha 14:20, 15. Dez. 2010 (CET)
- Weshalb so dünnhäutig, wenn's um Sinn oder Unsinn einer Kat geht? Ich habe jetzt Kategorie:Ehemals holsteinische Gemeinde in Hamburg als Unterkat angelegt. Scheint mir die einfachste der korrekten Lösungen zu sein. Und ja, auch eine weitere Unterkat à la Kategorie:Ehemals hannöversche Gemeinde in Hamburg wäre sinnvoll. -- Wwwurm Mien Klönschnack 09:59, 15. Dez. 2010 (CET)
- Prima Einstellung, Leute wie dich brauchen wir hier. Gemeinden aus Nordschleswig haben übrigens im Katbaum Kategorie:Ehemalige Gemeinde in Deutschland nichts zu suchen, genauso wenig wie die aus Elsaß-Lothringen oder Oberschlesien.-- Definitiv 09:31, 15. Dez. 2010 (CET). -- Definitiv 09:31, 15. Dez. 2010 (CET)
- Ist mir völlig egal was mit Harburg und Rüstringen passiert. Bei Schleswig-Holstein habe ich es vielleicht etwas einfacher, da Provinz und Bundesland weitestgehend identisch. Es gibt aber tatsächlich eine Unterkategorie für die 1920 an Dänemark abgetretenen Gemeinden, u.a. auch weil es so viele sind. --Ohauahauaha 09:24, 15. Dez. 2010 (CET)
- Moment mal. Mag ja sein, dass diese Gliederung nach Bundesländern durchgeführt ist, aber auch dann sind Altona usw. keine ehemaligen Gemeinden in Hamburg. Das Bundesland gibt es erst seit 1948(?) und da waren Altona&Co. schon lange eingemeindet. Fakt ist Altona usw. waren Gemeinden in der ehemaligen preußischen Provinz in Schleswig-Holstein. Also entweder eine entsprechende Kategorie verwenden oder Provinz und Bundesland für die Kategorie gleichsetzen. (Ich bin für letzteres, das dies in S.-H. nicht kompliziert ist.) Aber nicht "Ehem. Gemeinde in Hamburg". -- Ohauahauaha 07:53, 15. Dez. 2010 (CET)
- Warum erzählst Du das mir und nicht dem Kat-Projekt, wo das ellenlang diskutiert worden ist? Klein-Flottbek ist eine ehemalige Gemeinde auf dem Gebiet des jetzigen Landes Hamburg und die Kategorie:Ehemalige Gemeinde in Deutschland ist nach den 16 aktuellen Bundesländern (und nicht nach früheren preußischen Provinzen) gegliedert. Wo Problem? Gruß -- Definitiv 23:08, 14. Dez. 2010 (CET)
- NB: Ich konnte das auch unter Deinem Link http://www.gemeindeverzeichnis.de nicht finden; gibt's da eine genauer auf die von Dir gemeinte Unterseite führende URL?
- z.B. http://www.gemeindeverzeichnis.de/gem1900//gem1900.htm?schleswig/pinneberg.htm -- Definitiv 23:08, 14. Dez. 2010 (CET)
- Danke. Ich hatte logischerweise unter Gemeinden in Hamburg gesucht, weil ich annahm, dort stünde etwas über Gr./Kl.Flottbeks Gemeindestatus in Hamburg... Dass es in Holstein eine war, weiß ich ja. ;-) -- Wwwurm Mien Klönschnack 23:41, 14. Dez. 2010 (CET)
- z.B. http://www.gemeindeverzeichnis.de/gem1900//gem1900.htm?schleswig/pinneberg.htm -- Definitiv 23:08, 14. Dez. 2010 (CET)
Aber mal im Ernst: Alle "Tatsachen" die hier stehen sind doch unbewiesen und nicht dokumetiert! Wirklich! Rolz-reus 15:56, 24. Dez. 2010 (CET)
- Trotzdem schöne Weihnachten und einen Guten Rutsch!-- Definitiv 16:08, 24. Dez. 2010 (CET)
(dein Edit): Bensen war nie eine Gemeinde des Landkreises Hameln (nach meinem Verständnis des Begriffs "Gemeinde"). 1973 wurde Bensen Ortsteil von Hessisch Oldendorf. Bis dahin war es eine Gemeinde des Landkreis Grafschaft Schaumburg. Erst 1977 wurde dann Hess. Oldendorf mit dem Ortsteil Bensen in den Landkreis Hameln eingeordnet. Gleiches gilt in meinen Augen auch für die anderen Ortsteile von Hess. Oldendorf. --Of 22:47, 20. Jul. 2011 (CEST)
- Hallo Of, du hast vollkommen Recht, Bensen war nie eine Gemeinde des LK Hameln sondern die Gemeinde Bensen gehörte zur Zeit ihrer Existenz zum LK Gs. Schaumburg. Nun stellt sich aber generell die Frage, ob man ehemalige Gemeinden nach ihrem damaligen LK oder nach dem LK, in dem ihr Gebiet heute liegt , kategorisiert. Und in dieser mühsamen Diskussion ist nun mal rausgekommen, nach heutigen LK zu kategorisieren, siehe zB Kategorie:Ehemalige Gemeinde in Baden-Württemberg, wo die ehemaligen Gemeinden von BaWü flächendeckend nach ihrer Lage in den heutigen LK kategorisiert sind. Und deswegen ist Bensen in der Kategorie:Ehemalige Gemeinde (Landkreis Hameln-Pyrmont) gelandet. Gruß --Definitiv 08:18, 21. Jul. 2011 (CEST)
Kategorie:Ehemalige Gemeinde (Salzgitter)
[Quelltext bearbeiten]Hallo Definitiv, als Salzgitteraner verstehe ich Deine neu angelegte Kategorie nicht. Diese ist - mit Ausnahme des fehlenden Stadtteils "Salzgitter-Bad" - identisch mit der "Kategorie:Ort in der kreisfreien Stadt Salzgitter", kann also eigentlich entfallen. Überdies ist diese Kategorie aus der geschichtlichen Sicht völlig falsch gewählt: es gab nie eine Stadt oder einen Kreis Salzgitter mit selbstständigen Gemeinden wie Hohenrode oder Lobmachtersen. Sämtliche heutigen Stadtteile von Salzgitter gehörten vor dem 1. April 1942 (Sauingen und Üfingen bis 1974) den Kreisen Goslar oder Wolfenbüttel an und sind seitdem der damals neu gegründeten Stadt Salzgitter - diese hieß bis 1951 Watenstedt-Salzgitter - eingemeindet worden. Vor 1942 gab es lediglich eine Gemeinde "Salzgitter" - auch "Bad-Salzgitter" genannt - die zum Landkreis Goslar gehörte und die als Stadtteil von Salzgitter dem heutigen "Salzgitter-Bad" entspricht. Historisch korrekt wäre es gewesen, die beiden Kategorien "Ehemalige Gemeinde von Goslar / Wolfenbüttel" zu erstellen und die Salzgitterschen Stadtteile diesen zuzuordnen. in der jetzigen Form ist sie historisch falsch und wegen des gleichen Inhaltes wie die Kategorie "Ort in der kreisfreien Stadt Salzgitter" auch überflüssig. Gruß -- Johamar 22:01, 25. Jul. 2011 (CEST)
- Hallo Johamar, alle historischen Fakten die du erwähnst sind richtig, Antwort siehe eins drüber, exakt selbe Sachlage wie Bensen/Landkreis Hameln-Pyrmont, exakt dieselbe Problematik etc etc. Zum Verständnis der Ehemalige-Gemeinden-Systematik geh bitte auf Kategorie:Ehemalige Gemeinde in Deutschland und klick nacheinander in die Bundesländer, dann siehst du den Sinn von Kategorie:Ehemalige Gemeinde (Salzgitter) und die Einbettung in die bundesweite Systematik. Beschlusslage ist nun mal, in der WP werden ehemalige Gemeinden nach Jetzt-Kreisen kategorisiert und nicht nach Ex-Kreisen. Die Kat-Definition ist außerdem sprachlich/logisch wasserdicht. Gruß --Definitiv 22:18, 25. Jul. 2011 (CEST)
- Dann beuge ich mich dem Mehrheitsbeschluss, auch wenn m.E. der Name der Kategorie aus historischer Sicht missverständlich ist. Danke für Deine Antwort. Gruß -- Johamar 08:04, 26. Jul. 2011 (CEST)
Hallo, ich bin definitiv erfreut darüber, dass mein Artikelchen Amt Friesoythe einen (besseren) Nachbarartikel bekommen hat. Gruß --Pelagus 16:07, 29. Aug. 2011 (CEST)
- Danke, ich wollte dich auch schon zum Thema Amt Friesoythe anschreiben: Die Gemeindeeinteilung die du dort von http://www.geschichte-on-demand.de/cloppenburg.html übernommen hast (z.B. Gemeinde Saterland) beschreibt die Gemeinden im Amt/Landkreis Cloppenburg nach der 1933er Gebietsreform bzw. nach der Eingliederung des Amtes Friesoythe. Die Gemeinden des Amtes Friesoythe in seinem letzten Zustand vor der Auflösung kannst du hier oder visuell auch hier sehen. Das müsste in Amt Friesoythe eigentlich noch korrigiert werden (kann ich gerne auch selber machen). Die Auflistung der einzelnen Orte und Bauerschaften in Amt Friesoythe finde ich gut, die an die Gemeinden vor 1933 anzupassen, wird vermutlich etwas Arbeit erfordern. Gruß--Definitiv 18:47, 29. Aug. 2011 (CEST)
Franz
[Quelltext bearbeiten]Du hast ja unter Benutzer:Definitiv/Wilhelm Franz (Abgeordneter) schon einen schönen Artikel zu dem noch fehlenden Abgeordneten vorbereitet. Wann gedenkenkst du den in den ANR zu überführen? Da ja auch bald alle MdBs fertig sein werden, würde das gut passen. 88.130.219.229 10:38, 6. Jan. 2012 (CET)
- Hallo, danke für den Hinweis. Letzter Stand der Diskussion war hier: Wikipedia Diskussion:WikiProjekt Politiker/Archiv/2011-1#Franz. Seitdem hat sich an der Faktenlage nichts geändert. Ich möchte ungern hier vorpreschen und würde den Artikel eigentlich nur mit ausdrücklicher Zustimmung von Benutzer Ephraim 33 in den ANR verschieben wollen. Du kannst aber vielleicht im Projekt Politiker nochmal eine Diskussion anstoßen. Gruß --Definitiv 12:12, 7. Jan. 2012 (CET)
- Naja, aber siehs mal so: Wenn demnächst im Kurier steht, dass alle MdB vollständig sind, dann wäre es doch wunderbar, wenn im selben Atemzug verkündet werden könnte, dass alle obersten deutschen Abgeordneten seit 1867, also Norddeutscher Bund, Kaiserreich, Weimar, 3. Reich und Bundestag, vollständig sind. Sonst müsste man das irgendwann anders noch nachschieben, was nicht so schön wäre. 88.130.219.59 21:13, 8. Jan. 2012 (CET)
- Eventuell wurde jetzt endlich das letzte Puzzleteil gefunden, siehe Benutzer_Diskussion:Ephraim33#Wilhelm_Franz. 129.13.72.198 15:12, 14. Jul. 2016 (CEST)
- Danke für die Spurensuche und den Hinweis -> Wilhelm Franz (Politiker) jetzt veröffentlicht. --Definitiv (Diskussion) 10:22, 15. Jul. 2016 (CEST)
Tag. Das da, genauer der Bearbeitungskommentar, enthält eine Unterstellung und eine Beleidigung. Beides wendet sich gegen mich. Und ich bitte doch in Zukunft davon Abstand zu nehmen, andere Leute so zu behandeln. Da magst Du Bielefeld und wasweißichwem in besonderem Maße verbunden sein - eine besondere Verbindung schaffst Du Dir mit mir auf diese Weise jedenfalls nicht. Definitiv. Abgesehen davon ist es immer schlecht, in solchen Situationen emotional motiviert zu handeln - geht doch dabei ganz gern und wie hier bewiesen der Blick in's eigene Unvermögen in's Leere. Anderenfalls wäre Dir vielleicht doch aufgefallen, dass nicht Häuser nummeriert werden, sondern Straßen oder auch, dass eine Straße, die schon einen Namen hat, nicht eine Namensgebung zu erwarten hat, sondern eine Umbenennung. Beispielsweise. Ich höre aber mal auf, es ist völlig bescheuert, hier stundenlang die Tastatur zu bedienen, nur, weil ein Mitarbeiter etwas aufgebraus ist. Ach ja: Die VM fällt für dieses Mal aus, aber nicht deshalb, weil ich das toll finde, wie Du Dich benimmst, sondern weil ich mich nicht zwingend auf das Niveau begeben möchte. Bei Wierderholung könnte ich allerdings anders entscheiden. In diesem Sinne.. Bekannter Teilnehmer 19:32, 17. Jan. 2012 (CET)
- Prima, und wenn wir uns jetzt noch darauf einigen, dass dein Edit einen Kleinbuchstaben am Satzanfang hinterlassen hatte und war war geschrieben wird und nicht warr, dann ist ja jetzt alles in Butter.--Definitiv 19:56, 17. Jan. 2012 (CET)
- Ja. ;-) Bekannter Teilnehmer 20:09, 17. Jan. 2012 (CET)
- Vergessen wir mal deine Rechtschreibprobleme. Auf jeden Fall vielen Dank für deine Verbesserungen des Artikels U-Bahnhof Neue Grottkauer Straße, die in der Löschprüfung nunmehr zu der Admineinschätzung .....durchaus interessant und gibt zeitgeschichtliche Informationen weiter, die es anderswo nicht gibt und zu einer Behaltensentscheidung geführt haben. Schade, dass du trotzdem dauerhaft gesperrt worden bist! Gruß--Definitiv 09:06, 24. Jan. 2012 (CET)
- Ja. ;-) Bekannter Teilnehmer 20:09, 17. Jan. 2012 (CET)
Lieber Definitiv, ich möchte mich bei dir herzlich für deine Mitarbeit in der Wikipedia bedanken. Deine Arbeit an den Reichstagsabgeordnetenlisten hat es ermöglicht, einen Überblick über die Mitglieder des Reichstages zu erhalten und schließlich alle fehlenden Artikel anzulegen. Und auch bei den Bundestagsabgeordneten hast du mit angepackt, um auch diese vollständig mit Artikeln zu versorgen. Nicht zuletzt hast du auch Artikel zu Verwaltungsbezirken, Land- und Wahlkreisen angelegt und die relativ undankbare Kategorisierungsarbeit übernommen. Dafür sage ich Danke und wünsche dir eine schöne Woche, Ephraim33 (Diskussion) 18:00, 12. Mär. 2012 (CET)
- Glückwunsch. Mehr geadelt kann man in diesem Projekt nicht werden! :) Aber ich kann Ephraim auch nur zustimmen. Marcus Cyron Reden 19:04, 12. Mär. 2012 (CET)
Vielen Dank an Euch für die netten Worte. Bei dieser Gelegenheit möchte ich nochmal an unsere alte Baustelle Franz , Abgeordneter im Reichstag des Norddeutschen Bundes erinnern. Ephraim33, du hattest hier enorme Aufklärungsarbeit geleistet, warst dir aber noch nicht hundertprozentig sicher. Ich habe seitdem leider auch nichts zusätzliches gefunden. Das was bekannt ist, habe ich mal unter der Annahme, dass es bei allen Merkmalen immer um denselben Franz geht, zu einem Stub kondensiert: Wilhelm Franz (Abgeordneter). Soll man das nun veröffentlichen oder wollen wir noch weitere glasklare Belege abwarten? Gruß--Definitiv (Diskussion) 18:49, 13. Mär. 2012 (CET)
- Hast du schonmal Fachleute deswegen angefragt? Wir haben mehrere Dutzend Unis allein in Deutschland mit Geschichtswissenschaftlichen Lehrstühlen, dabei immer mit Neuzeit-Professuren. Da muß es doch Leute geben, die in der Sache mindestens was raus bekommen müßten, wenn sie schon nicht sofort Antworten parat haben. Marcus Cyron Reden 22:54, 13. Mär. 2012 (CET)
Um letzte Gewissheit zu erlangen, könntest du bei der Wikipedia:Bibliotheksrecherche anfragen. Die müssten an die beiden vielversprechenden Bücher (1 und 2) eigentlich rankommen. Und wenn du dort die Wichtigkeit erklärst (immerhin geht es um den allerletzten Reichstagsabgeordneten ohne Artikel), machen sich die Leute von der Bibliotheksrecherche vielleicht sogar die Arbeit die entsprechenden Stellen in den Büchern zu suchen. (Das erste Buch hat 304 Seiten und das zweite 128. Hoffentlich haben die wenigstens ein Register.) Wäre toll, wenn der Artikel nach der langen Vorbereitungszeit dann online gehen könnte. --Ephraim33 (Diskussion) 19:33, 18. Mär. 2012 (CET)
Gibt es einen neuen Stand? Marcus Cyron Reden 01:34, 27. Mai 2012 (CEST)
Ich hiefe das mal erneut auf die Agenda ;). Marcus Cyron Reden 01:47, 26. Jul. 2015 (CEST)
Mitglied des Bundestags Almut Kottwitz
[Quelltext bearbeiten]Ich begrüße es, dass Sie die Änderungen im Artikel zur Kenntnis genommen haben, da Sie anscheinend der Autor sind.
Woher hatten Sie die im Artikel enthalten, teilweise falschen Informationen?
Ich finde Ihr Diskussionsbeitrag zu den Änderungen des von Ihnen verfassten Artikels verstößt erheblich gegen die guten Sitten.
So wird auch verständlich, dass Almut Kottwitz, als ich 2011 anfragte diesen Artikel zu erstellen, mir sagte, dass sie keinen Artikel über ihre Person wünscht.
ATLANTIS (Diskussion) 22:10, 20. Jun. 2012 (CEST)
- Hallo, über welche Bundestagsabgeordneten in der WP Artikel erstellt werden, bestimmst weder Du noch der betreffende MdB. Insbesondere werden die betreffenden MdB hierzu nicht "angefragt". Alle Informationen in der von mir erstellten Erstfassung des Artikels habe ich im Wesentlichen dem im Artikel genannten Standardwerk entnommen. So wie ich das sehe, sind sie auch noch sämtlich in dem aktuellen Stand des Artikels enthalten, d.h. sooo falsch sind sie vermutlich nicht. Welche "falschen Informationen" sollen das also sein? Als ich das gerade im genannten Artikel überprüft habe, habe ich allerdings festgestellt, dass dort nachträglich enzyklopädisch irrelevante Informationen zu einer enzyklopädisch irrelevanten weiteren Person eingebaut wurden und dass der Artikel dadurch mittlerweile in einem qualitativ eher bedauerlichen Zustand ist. Tja, da kann man nichts machen. Artikel, deren Erstfassung ich erstellt habe, sind nun mal in keinster Weise mein Eigentum oder irgendwie sakrosankt und dürfen selbstverständlich von jedermann nach Belieben editiert (und kommentiert!) werden. Wenn du grundsätzliche Probleme mit den in der WP geübten Verfahrensweisen zu Bundestagsabgeordneten und deren Biografien hast, mache die doch bitte in Wikipedia Diskussion:WikiProjekt Politiker publik, da wird dir bestimmt geholfen. Gruß --Definitiv (Diskussion) 08:41, 21. Jun. 2012 (CEST)
1. Natürlich hätte ich einen Artikel über die Politikerin Almut Kottwitz erstellen können. Ich tat es nicht, da sie es nicht wollte.
2. Natürlich hat sie kein Recht die Erstellung eines Artikels durch einen Dritten zu verhindern, da sie mit Annahme des Mandats als Politikerin im "öffentlichen Interesse" steht.
3. Die nicht zutreffenden Passagen:
a) der Grund für den Aufenthalt in Brasilien und
b) die Tätigkeit als Sprecherin des Kreisverbandes Bergisch Gladbach. Eine Ämterhäufung war damals im Kreisverband politisch nicht erwünscht.
4. Fragen zur Qualität des Artikels diskutiere ich gerne. Irrevelante Informationen sollten entfernt werden, wenn diese als solche benannt werden können.
5. Zu Ihrem beleidigenden Diskussionsbeitrag haben Sie keine Stellung bezogen! Sie sollten sich die Grundsätze über das Verhalten bei Wiki auf Ihrer eigenen Seite noch einmal durchlesen...
ATLANTIS (Diskussion) 21:53, 21. Jun. 2012 (CEST)
- Geht doch. Alle Gründe für Spott und Kritik meinerseits sind jetzt wieder entfallen. Gruß --Definitiv (Diskussion) 19:00, 10. Jul. 2012 (CEST)
So einfach geht das nicht, denn der Spott und die Kritik sind gespeichert. Die Gründe für Ihre Kehrtwende sind nicht ersichtlich. In Ihrem Beitrag auf der Diskussionssseite von Almut Kottwitz verbleibt ein Beigeschmack, der vernab jeder Realität ist: MdB Almut Kottwitz hätte niemals einen Büchertisch in Berlin betreut. Sie hatte aber 1988 das Glück im Wahlkreis Bergisch Gladbach einen Listenplatz der Grünen zu erhalten, der mit dem Rückzug von Otto Schily die Übernahme dieses Mandates ermöglichte. Das Ganze wurde nur möglich dadurch, dass ihr Ehemann sie voll unterstützte, dieses Abenteuer anzunehmen. Er selbst geriet aber dadurch in eine bis heute anhaltende, tiefe Krise.
--ATLANTIS (Diskussion) 01:39, 20. Jul. 2012 (CEST)
Quelle?
[Quelltext bearbeiten]Moin, Definitiv. Worauf stützt sich diese Änderung? Und: Deine Quelle – die ich Dich im Artikel zu referenzieren bitte – nennt zwar die Paarung, aber nicht das Ergebnis? Gruß von --Wwwurm Mien Klönschnack 10:19, 10. Jul. 2012 (CEST)
- Hallo und Danke für den Hinweis. Eigentlich wollte ich nur den Eintrag für das 1932er-Rotsport-Endspiel mit den beiden Artikeln Kampfgemeinschaft für Rote Sporteinheit und Liste der deutschen Fußballmeister#Meister der Kampfgemeinschaft für Rote Sporteinheit (1931–1932) abgleichen; d.h. 1931 Rotsport-Meister Dresdner SV und 1932 Rotsport-Meister die FT Jeßnitz. Nun hat Hardy Grüne in seiner Enzyklopädie des deutschen Ligafussballs des deutschen Ligafussballs behauptet, 1931 und 1932 hätte jeweils dasselbe Rotsport-Endspiel mit denselben Teilnehmern, demselben Ergebnis und bei beiden Mannschaften mit exakt denselben Aufstellungen stattgefunden. Datum und Ort beider Endspiele nennt er aber ausdrücklich nicht. Diese Theorie hat offenbar teilweise auch Einzug in die WP gefunden, da Hardy Grüne normalerweise eine ziemlich verlässliche Quelle ist. Hardy Grüne ist aber nicht unfehlbar, und mittlerweile ist er offenbar widerlegt: Christian Wolter, Rasen der Leidenschaft gibt für das 1932er Rotsport-Endspiel (Jeßnitz gegen BV Gelsenkirchen) exakte Daten und insbesondere die FT Jeßnitz als Rotsport-Meister an. Den Wolter habe ich jetzt als Beleg eingetragen. Gruß --Definitiv (Diskussion) 17:48, 10. Jul. 2012 (CEST)
- Stimmt, als ich den Artikel vor etlichen Jahren anlegte, habe ich mich auch auf Grüne gestützt; dabei weiß ich schon lange, dass man auch seine Angaben gegenchecken sollte. Ansonsten Danke für's Erledigen. Gruß von --Wwwurm Mien Klönschnack 17:51, 10. Jul. 2012 (CEST)
Nur mal so
[Quelltext bearbeiten]Danke für für, die, geleistete Arbeit.--Es grüßt: Der Sepp Sabbelecke 13:17, 27. Jul. 2012 (CEST)
- Danke, den Lob verdient hat aber eher Christian Wolter für sein tolles Buch über die alten Berliner Fußballplätze. Dort kann man wirklich unheimlich viel Stoff finden.--Definitiv (Diskussion) 13:20, 27. Jul. 2012 (CEST)
- Ich weiß. Hab das Buch selber zuhause rumzuliegen, fand aber bis jetzt nicht die Zeit, das ganze auch mal in die Artikel einfließen zu lassen.--Es grüßt: Der Sepp Sabbelecke 13:29, 27. Jul. 2012 (CEST)
Lob
[Quelltext bearbeiten]
Nur ein kleiner Hinweis darauf, daß ich mich bemüht habe hiermit Deinen Leumund zu verbessern. Kommt sehr selten vor, daß jemand mal eigene Fehler eingesteht und seien sie auch noch so klitzeklein (wie in diesem Fall sicherlich). --Kängurutatze (Diskussion) 22:26, 11. Mär. 2013 (CET)
Distrikt Rinteln im Weserdepartement
[Quelltext bearbeiten]Hallo,
du hattest mal den Distrikt Rinteln im Weserdepartement angelegt und mit reichlich Ortstabellen bestückt. Da ich die Artikel mittlerweile getrennt habe und dabei bin, die Kantonsartikel zu erstellen, muss ich unbedingt wissen, welche Quellen du für die Munizipalitäten der neu gegründeten Kantone Hameln, Aerzen, Münder, Hemmendorf, Bodenwerden, Börry verwendet hast und ob es Sammlungen der Westphälischen Ortslisten nach 1810 online gibt. Das war im Artikel nicht angegeben. Du kannst es auch auf diese zugegeben beschämend unvollständige Arbeitsseite schreiben. Es grüßt --Der angemeldet Seiende (Diskussion) 12:29, 13. Mai 2013 (CEST)
- Hallo, meine Quelle war das Statistische Repertorium über das Königreich Westphalen in dem du höchstwahrscheinlich alles findest was du brauchst. Hab ich wohl seinerzeit vergessen anzugeben. Ob es unterhalb der Kantone im Kgr. Westphalen bzw. im französischen Machtbereich in Deutschland echte "Munizipalitäten" gab, bin ich mir nicht ganz sicher. Für meine Begriffe bestanden die Kantone aus (weltlich) uninkorporierten Dörfern und Orten. Gruß --Definitiv (Diskussion) 13:48, 13. Mai 2013 (CEST)
Danke, das hatte ich völlig vergessen. Dass das Königreich echte Munizipalitäten hatte ist in der Verfassung festgeschrieben. Nur an der Umsetzung hat es freilich gemangelt--Der angemeldet Seiende (Diskussion) 15:38, 13. Mai 2013 (CEST).
- Wobei der Raum Bielefeld durchaus gründlich durchgegliedert wurde, dort wurden in den meisten Kantonen jeweils zwei explizite Munizipalitäten eingerichtet. Siehe diese Quelle, aus der allerdings auch klar hervorgeht, dass zumindest in der Region Bielefeld die einzelnen Dörfer eben keine Munizipalitäten waren. Eine Gesetzesquelle für die Kantonsabgrenzungen habe ich jetzt auch noch zu bieten: Bulletin des lois du Royaume de Westphalie, Band 6, ab Seite 369. Gruß--Definitiv (Diskussion) 17:36, 13. Mai 2013 (CEST)
- Ah natürlich. Da haben wir uns missverstanden. Die einzelnen Dörfer können freilich nicht mit Munizipalitäten gleichgesetzt werden, die wurden oftmals zusammengefasst. Ich meinte, dass die Munizipaleinteilung klar gesetzlich festgelegt war, was ja dein Beispiel auch sehr deutlich macht. Die einzigen konkreten Hinweise auf die Einteilung sind jedoch die gesetzten Semikola in dem Ortsverzeichnis des ersten Gesetzesbulletins, um das mal an diesem willkürlichen Beispiel zu verdeutlichen.
- Wenn du Zeit hast, mach doch bei meiner Arbeitsliste mit. Ich bin noch lange nicht damit fertig, aufzuschreiben, was alles aus dieser Zeit fehlt. Es grüßt --Der angemeldet Seiende (Diskussion) 18:07, 13. Mai 2013 (CEST)
Hallo Definitiv, der Hintergrund der Geschichte: Die USA hat Starke verhaftet, als "Ausgleich, Druckmittel oder Austauschkanditat (genaues ist nicht mehr nachvollziehbar" weil die Sowjets zuvor Paul Schwarz verhaften hatten. Die Aussage von Horst Behrendt (einem Arbeitskollegen Starkes) auf ag-friedensforschung.de, Starke ist abgesetzt worden ist zwar richtig, aber unvollständig. Starke ist nicht sofort, sondern erst nach den Wochen der Haft (meines Wissens war Starke erst an Silvester 45/46 wieder zu Hause, Horst und Fritz feierten das beide zusammen). Entlassen wurde Starke letztlich, weil er nichts mit der Verhaftung von Schwarz nichts zu tun hatte. Das Starke durch seine nicht-selbstverschuldete Verhaftung auf die Amerikaner sauer war, ist verständlich und so verzichtete nach seiner Entlassung auf das Amt. Deswegen mein Eintrag für seine Zeit als Steglitzer BB 1945-46 Gruß --webcyss (Diskussion der Benutzerin) 16:40, 27. Jun. 2013 (CEST)
- Hallo, wenn ich dich richtig verstehe, dann sollen also die Amerikaner im Juli zu Fritz Starke gesagt haben "Fritz, wir verhaften dich jetzt, aber keine Angst, du bleibst als Bezirksbürgermeister im Amt und wenn wir dich wieder aus der Haft entlassen, dann darfst du im Bezirk Steglitz weitermachen wie zuvor." und gleichzeitig zu Arthur Jochem "Arthur, mach mal vorübergehend Bürgermeister, aber wenn wir den Starke wieder rauslassen, dann verschwindest du bitte wieder". Es soll also von Juli 1945 bis irgendwann in 1946 zwei Bezirksbürgermeister in Steglitz gegeben haben, einen echten, im Gefängnis, und einen "kommissarisch" amtierenden nicht so ganz echten.
- Gibt es irgendwelche Belege für diese steile These??????
- Der genannte Ablauf widerspricht
- a) jeglicher Erfahrung und Schilderungen aus der direkten Nachkriegszeit. Berliner Bezirksbürgermeister wurden damals von allen vier Besatzungsmächten nach Belieben von heute auf morgen eingesetzt und abgesetzt. Und das nicht mit irgendwelchen Vorbehalten oder Rücksichten aufs Beamtenrecht. Deswegen gab es in 1945/46 viele Bezirksbürgermeister mit teilweise nur wenigen Wochen Amtszeit.
- b) einer Menge von Einträgen in irgendwelchen Chroniken so wie 23.7.45 Die Amerikanische Militärregierung setzt Arthur Jochem als neuen Bezirksbürgermeister von Steglitz ein. Es gibt mit ziemlicher Sicherheit, ohne dass ich sie jetzt direkt zur Hand hätte, zahlreiche weitere Belege in seriöser Literatur für diesen Ablauf. Gruß --Definitiv (Diskussion) 18:58, 27. Jun. 2013 (CEST)
Karten von Kreise in der DDR
[Quelltext bearbeiten]Moi Definitiv, Vor einigen Monaten habe ich angefangen über den Kreisen in der DDR zu schreiben. Erstens herzlichen Dank für deine Arbeit. Die Artikeln in dem deutschsprachigen Wikipedia sind mir sehr hilfreich. Ich habe aber eine Frage. Ich sehe du hast auch den Karten der Kreise gebastelt. Wie findest du es wenn ich das Farbschema ändere? Ich habe schon ein Beispiel gemacht, aber möchte gerne erst Mal überlegen. Beispiel. MfG, --Meerdervoort (Diskussion) 21:53, 23. Okt. 2013 (CEST)
- Hallo Meerdervoort, ich hab da kein Problem mit, wenn du die Karten veränderst. Ich habe damals bereits vorhandenene Karten verwendet und dann mit mspaint ein bisschen getrickst. Gruß --Definitiv (Diskussion) 08:39, 24. Okt. 2013 (CEST)
- Herzlichen dank für deine Antwort. Ich habe bereits ein paar neue Karten hochgeladen. --Meerdervoort (Diskussion) 13:54, 30. Okt. 2013 (CET)
Hallo Definitiv, du hast im Artikel Amt Werther die Kategorie:Kreis Gütersloh ergänzt. Die beiden haben jedoch nie parallel exisitert, da das Amt Werther 1972 aufgelöst und der Kreis Gütersloh 1973 errichtet wurde. Deshalb frage ich mich, ob das so Sinn macht. Sollte man nicht viel mehr eine Kategorie Kreis Halle erstellen und die entsprechenden Ämter dort auflisten? Dies betrifft auch weitere Ämter und Kreise. Mir fällt spontan kein Beispiel ein, aber was ist, wenn ein Amt unter zwei Kreisen aufgeteilt wurde? Sollte es dann in beiden Kreis-Kategorien auftauchen? Viele Grüße --DaBroMfld (Diskussion) 11:40, 14. Nov. 2013 (CET)
- Eine Kategorie Kreis Halle wäre im Prinzip richtig, ist aber allgemein unerwünscht und würde riesigen Löschärger erzeugen ("wir kategorisieren nicht nach historischen Gebietseinheiten") . Schon besser wäre eine Kat "Ehemaliges Amt (Kreis Gütersloh)", die genau wie bei der "Ehemalige Gemeinde (Kreis ...)"-Kat alle Ämter listet, die auf dem Boden des Kreis GT bestanden. Sollte dann aber flächendeckend in ganz NRW so gemacht werden und ist ein bißchen viel des Guten. Die Kategorisierung unter Kreis Gütersloh impliziert ja nicht, dass es Ämter des Kreises Gütersloh waren (siehe auch die ganzen napoleonischen Kantone, Distrikte etc), es ist somit auch m.E. problemlos möglich, ein ehemaliges Amt in zwei aktuellen Kreisen zu kategorisieren (siehe wieder Napoleon mit seinen Distrikten etc..) . Mir ging es zunächst nur darum, dass man alle Ämter, die es im Kreisgebiet je gab, an einer Stelle im Kat-System vollständig zusammmen sehen kann, mehr nicht. Gruß --Definitiv (Diskussion) 11:57, 14. Nov. 2013 (CET)
- Okay, dann halte ich erstmal die Füße still ;-). Das ganze Kategorien-System wird uns eh irgendwann mal um die Ohren fliegen. Amt Harsewinkel käme dann sowohl in Kategorie:Kreis Warendorf und in Kategorie:Kreis Gütersloh? Und müsste dann nicht auch Kreis Warendorf in Kategorie:Kreis Gütersloh? Aber dann wird es völlig chaotisch :-(. Viele Grüße --DaBroMfld (Diskussion) 12:20, 14. Nov. 2013 (CET)
Größtes Dorf...
[Quelltext bearbeiten]Hi Definitiv! Sehe ich bei Brackwede im Grunde genauso, wird zwar immer mal wieder kolportiert, aber einen Nachweis habe ich auch in keiner Literatur entdeckt. Frage wäre ja auch: welcher Europabezug? Fläche, Einwohenr etc. etc.... Danke für deinen Hinweis! --Bielibob (Diskussion) 16:58, 5. Jan. 2014 (CET)
- Die Aussage bezieht sich auf die für eine Gemeinde ohne Stadtrecht im Jahre 1956 in der Tat recht hohe Einwohnerzahl (die genaue Einwohnerzahl Brackwedes im Jahr 1956, auf die es hier ankommt, habe ich leider noch nicht gefunden). Der heißeste Kandidat für einen deutschen Gegenbeweis scheint mir Falkensee zu sein. Ganz leicht ist die These widerlegt, wenn man nach England schaut, dort gab es in den 1950ern Gemeinden ohne Borough- oder City-Status mit mehr als 50.000 Einwohnern, Feltham Urban District nur ein Beispiel. Gruß--Definitiv (Diskussion) 17:37, 5. Jan. 2014 (CET)
- Jipp. Ähnlich NL: dort ist die gemeente ja an sich die dritte Verwaltungsebene seit den Franzosen. Also lassen wir es so. Bedankt. --Bielibob (Diskussion) 18:08, 5. Jan. 2014 (CET)
Ehemalige Gemeindekats
[Quelltext bearbeiten]Tachauch Definitiv,
ich halte diesen und diesen Edit für grundfalsch - besonders aber den erstgenannten.
Eigentlich ist schon die Kategorie:Ehemalige Gemeinde (Gelsenkirchen) falsch. Da wäre es sinnvoll, nach ehemaligem Kreis zu kategorisieren, und da war alles außer Buer und Horst (beide RE) Kreis BO (die meisten ab 1885 bis in die 20er dann Kreis GE). Buer war jedenfalls, solange es diesen Ort als selbstständigen gegeben hatte, nie im Herrschaftsbereich von Gelsenkirchen gewesen, sondern schon immer Vest Recklinghausen und Nachfolger Kreis Recklinghausen - ein paar Jahre dann noch kreisfrei. Und Altschermbeck war von 1816 bis zur Eingemeindung nach Schermbeck 1975 ebenfalls Kreis RE, analog Erle (Raesfeld), das eigentlich auch in die Ex-RE-Kat gehört, da es nie eine Gemeinde im Kreis Borken gewesen war. --Elop 11:44, 22. Feb. 2014 (CET)
- Dazu gab es bereits eine ausführliche Diskussion mit dem Ergebnis, unabhängig von der damaligen Gebietszugehörigkeit die heutige zugrunde zu legen. Ein Nachteil wäre gewesen, dass man die historische Gebietszugehörigkeit in jedem Fall kennen müsste, die heutige ist bekannt oder zumindest einfach zu ermitteln. Ein weiterer Punkt wäre, dass ähnlich gelagerte Fälle unterschiedlich behandelt worden wären, z. B. Lippholthausen, Niederaden und Altlünen. Drittens gibt es einen Kategorienbaum, der, wenn man die aktuelle Gebietszugehörigkeit zugrunde legt, leicht anzulegen ist. Falls man nach den damaligen Gebietszugehörigkeiten sortiert, ist ein solcher Kategorienbaum nur sehr schwerlich aufzustellen, wenn es nicht gar unmöglich ist. MfG Harry8 13:22, 22. Feb. 2014 (CET)
- Wo ist denn jene Diskussion?
- Und wo kennen wir die ehemalige Zugehörigkeit nicht? Eher kennen wir doch die früheren Grenzen nur ungenau!
- Sehr oft ist der ehemalige Ort gar nicht mehr klar einer heutigen Obereinheit zuzuordnen. Die Bauerschaft Sinsen z. B. gehörte klar zum Amt Oer und wurde inzwischen zwischen Oer-Erkenschwick und Marl verteilt, wobei der einwohnermäßige Löwenanteil (Siedlung Sinsen, Ortsteil Sinsen-Lenkerbeck) heute zu Marl gehört. Ähnlich auch bei der ehemaligen Gemeinde Hamm (Amt Marl), die zwischen Haltern (Hamm-Bossendorf) und Marl (Marl-Hamm) aufgeteilt wurde mit deutlich mehr Einwohnern im Marler Teil, aber dem (früheren) Hauptort in Haltern.
- Natürlich könnte es bei einigen Orten epochenweise verschiedene Kats parallel geben. Aber das wäre ja auch nicht anders, wenn ein ehemaliger Ort zwischen zwei heutigen Kreisen aufgeteilt worden wäre (das träfe auf das erwähnte Hamm z. B. zu, wenn Haltern umgekreist würde, wie es ja die Halterner gerne hätten). --Elop 13:41, 22. Feb. 2014 (CET)
Hallo Elop, lies dir bitte die Kat-Definitionen von Kategorie:Ehemalige Gemeinde in Nordrhein-Westfalen, von Kategorie:Ehemalige Gemeinde (Gelsenkirchen), von Kategorie:Ehemalige Gemeinde (Kreis Wesel) usf usf noch einmal ganz gründlich und Wort für Wort durch. In diese Kat-Definitionen ist nämlich vor einigen Jahren erhebliche Diskussionsenergie und das seinerzeit maximale sprachliche Formulierungsvermögen der Beteiligten gesteckt worden. Und nein, Mülheim am Rhein war nie eine Gemeinde von Nordrhein-Westfalen. Und nein, Altschermbeck war nie eine Gemeinde des Kreises Wesel. Und ja, ein Nachbargemeinde von Breslau, die 1910 nach Breslau eingemeindet wurde, war sehr wohl eine Gemeinde von Deutschland. Und trotzdem haben wir in der WP festgelegt, dass alle ehemaligen Gemeinden nach heutigen Verwaltungsbezirken kategorisiert werden, und deswegen kommt Altschermbeck heute in die Kreis-Wesel-Kat und deswegen kommen ehemalige Breslauer Umlandgemeinden heute nicht in die Kategorie:Ehemalige Gemeinde in Deutschland sondern in den polnischen Kat-Baum. Was wirklich die einzige praktikable Lösung ist. Gruß --Definitiv (Diskussion) 14:12, 22. Feb. 2014 (CET)
- Was soll ich da denn lesen? Die dortige Systematik ist doch klar - und ich habe dargelegt, daß ich sie für Quatsch halte. Ich sehe auch nichts in Richtung Praktikabilität, was gegen eine sinnvollere Kategorisierung spräche. Wir haben ja sogar die Vorlage:Navigationsleiste Kreise und kreisfreie Städte in der Provinz Westfalen, in der es halt Kreis Lüdinghausen und andere noch gibt und die z. T. ja auch auf gleichnamige Vorgängerkreise explizit verlinkt, auch unter Deiner Mitwirkung.
- Die Kats wurden 2008 angelegt, als wir auf WP noch deutlich weniger Info hatten als heute. Ich habe bislang noch nichts gelesen, was gegen eine Änderung in Richtung damaliges Herrschaftsgebiet spräche.
- Nochmal die Frage:
- Wo finde ich denn die alte Diskussion? --Elop 15:14, 22. Feb. 2014 (CET)
- u.A. hier: Wikipedia_Diskussion:WikiProjekt_Kommunen_und_Landkreise_in_Deutschland/Archiv/2010
- Zur Handhabbarkeit verschiedener Kat-Modelle noch mal ein Beispiel: Die ehemalige Gemeinde Blankenstein gehörte nach 1817 erst zum Kreis Bochum, dann zum Kreis Hattingen und dann zum Ennepe-Ruhr-Kreis. Und davor zur Grafschaft Mark usw usw. --Definitiv (Diskussion) 15:46, 22. Feb. 2014 (CET)
- Hatte gestern mal in der Disk gestöbert. Will auf jeden Fall nicht eine nochmal so lange Disk raufbeschwören ...
- Wie würde das denn gelöst werden, wenn Hamm-Bossendorf und Marl-Hamm (hat noch keinen Artikel) per Umkreisung in 2 verschiedenen heutigen Landkreisen wären?
- Beide Lemmata stehen natürlich nicht unmittelbar namentlich für eine "ehemalige Gemeinde". Die wäre Hamm (Amt Marl) oder gar Hamm (Kreis Recklinghausen) (momentan Redir auf Hamm-Bossendorf, also Haltern), mit Hauptort im heutigen Haltern. Aber die Hälfte des Gemeindegebietes (und die Mehrzahl der Einwohner) waren zum Zeitpunkt der Auflösung auf heutigem Marler Gebiet. Ergo müßte (wenn den Haltern ausgekreist würde) doppelt kategorisiert werden, oder?
- Kreis Hattingen, Kreis Gelsenkirchen und schließlich Kreisfreie Stadt Gelsenkirchen (vor 1928) sind je Teil-Rechtsnachfolger des Altkreises Bochum. Typisch für das bevölkerungsmäßig explodierende Ruhrgebiet, während der Altkreis Soest ja ziemlich stabil blieb. Nähme man als Stichdatum "kurz nach 1815", wäre Westfalen gut in ehemalige Gemeinden aufteilbar. Wobei natürlich auch da (speziell im Ruhrgebiet) Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts welche hinzugekommen waren, die dann wieder irgendwann zu größeren Nachbarn eingemeindet wurden.
- Ist natürlich die Frage, wozu man die Kategorien braucht. Die meisten Nur-Leser benutzen sie eher nicht bzw. klicken drauf, ohne zu verstehen, daß das ein WP-internes, willkürliches Ordnungssystem darstellt und nichts "Amtliches".
- Ich bin wohl bei den Ex-Orts-Artikeln zu sporadisch aktiv, als daß ich mich da über Maßen engagieren würde. Wenn die tatsächlichen Alt-Strukturen in den Artikeln übersichtlich dargestellt sind, mag die Kategorisierung nach heutigem Gebietsstand eine Zusatzinfo bringen. --Elop 14:26, 23. Feb. 2014 (CET)
- Zu deiner ersten Frage:
- Ja, dann stehen sie in zwei Kategorien:
- Ausnahmen:
- Die Gemeinde wurde bereits in einer Gemeindegebietsreform vergrößert. Bei einer erneuten Reform wird diese auseinandergerissen. Der namensgebende Ort ist dann für die Kategorie maßgebend:
- So steht bei Rhynern die Hamm-Kategorie, bei Hilbeck die Kreis-Soest-Kategorie.
- Die Gemeinde wurde aufgeteilt. Beide Teile stehen in eigenen Artikeln.
- So steht bei Schröttinghausen (Bielefeld) die Bielefeld-Kategorie, bei Schröttinghausen (Werther) die Kreis-Gütersloh-Kategorie.
- Nur ein kleiner Teil der aufgelösten Gemeinde wurde abgetrennt.
- MfG Harry8 15:09, 23. Feb. 2014 (CET)
- Soweit logisch. Der Schröttinghausen-Fall ist ja mehr oder weniger analog zu Bövinghausen - nur das dieses nach unserem buisherigen Stand schon lange 2 getrennte Siedlungen waren (bei Castrop und bei Lütgendortmund).
- Kannst Du übrinx auf meiner Disk noch was zur von Dir die Tage eröffneten Dellwig-Holte-Frage sagen? Ist mit jener Website die Frage der Gemarkung Holte geklärt oder nach wie vor offen? --Elop 15:58, 23. Feb. 2014 (CET)
War dieses Jöllenbeck eine Gemeinde? Nach Reekers schon. Sie gibt eine Eingemeindung nach Gohfeld zwischen 1843 und 1858 an. Aber bei den Zahlen vor 1858 bin ich vorsichtig geworden. Kannst du da weiterhelfen? MfG Harry8 19:43, 1. Mär. 2014 (CET)
- Das Westfalenlexikon 1832–1835 erwähnt als Bestandteile des "Verwaltungsbezirks" bzw. der "Bürgermeisterei" Mennighüffen ein "Kirchdorf" Mennighüffen, "Dörfer" Grimmighausen und Oberbeck, ein "Kirchspiel" Gohfeld mit den "Ortschaften" Mellbergen, Depenbrock, Jöllenbeck und Bischofshagen, ein "Kirchdorf" Löhne, ein Dorf Löhne-Beck, ein Stift Quernheim "nebst" Klosterbauerschaft und Remerloh und ein "Kirchdorf" Lengern mit den "Dörfern" Häver und Quernheim. Aus diesem Sammelsurium mussten nun bei der Einführung der westfälischen LGO von 1841 "Ämter" und "Gemeinden" gebildet werden. Hierbei wurde offenbar nicht nur in verschiedenen Gegenden der Provinz Westfalen, sondern auch innerhalb einzelner Landkreise unterschiedlich kleinteilig vorgegangen. Die Gemeinden im Münsterland umfassten in der Regel mehrere Bauerschaften, in anderen Gegenden wurde je nach Siedlingsstruktur jede einzelne Bauerschaft oder jedes einzelne Dorf auch eine eigene Gemeinde. Der Kreis Herford wurde so organisiert; d.h. es wurden u.a. die beiden Ämter Mennighüffen und Gohfeld gebildet. Im Amt Mennighüffen wurden (sehr kleinteilig) acht Gemeinden (neben einem Rittergut) eingerichtet, im Amt Gohfeld jedoch nur zwei, nämlich Gohfeld und Löhne. Jöllenbeck also nicht. Mit ein Grund dafür mag gewesen sein, dass es sich bei Jöllenbeck offenbar wirklich nur um mehrere getrennt liegende Höfe ohne jeden Siedlungskern handelte, wie man auf dieser Karte gut sehen kann. Wie sehr sich die Verwaltungsstruktur der beiden Nachbarämter Mennighüffen und Gohfeld unterschied, kann man gut in dieser zeitgenössischen Tabelle erkennen, z.B. an den unterschiedlichen Größenordnungen der Einwohnerzahlen. So wie im Amt Gohfeld wurde übrigens auch im benachbarten Amt Vlotho vorgegangen. Auch die alten Bauerschaften Wehrendorf, Bonneberg, Hollwiesen, Steinbrünndorf und Solterwisch wurden keine Gemeinden sondern nur Teil der Gemeinden Exter und Valdorf. Im übrigen RB Minden gab es noch einige solche Fälle, so wurde im Kreis Bielefeld die Bauerschaft Lippe auch keine Gemeinde sondern Teil von Ubbedissen, genauso waren Hasenkamp im Kreis Minden sowie Eininghausen, Obermehnen und Heddinghausen im Kreis Lübbecke keine Gemeinden. Gruß --Definitiv (Diskussion) 10:53, 2. Mär. 2014 (CET)
- Herzlichen Dank für diese profunde Antwort. Du hast mir sehr geholfen. MfG Harry8 11:27, 2. Mär. 2014 (CET)
Rest des Amtes Buer
[Quelltext bearbeiten]Steht das da explizit drin - also daß der Rest des Amtes Buer genau aus Westerholt bestanden habe? Aus den Einwohnerzahlen kann ich da nicht viel schließen, da die Stadt ja noch in Expansion war (und in Scholven wohnte eh noch kein Schwein). Andererseits wäre es unlogisch gewesen, die beiden Bauerschaften zum Amt Westerholt zu schlagen.
Es klingt schon logisch, wie es jetzt da steht. Nur frage ich mich, wie die Genwikifritzen (bzw. Stratmann) darauf kommen. Die haben leider noch immer nicht gelernt, mit Einzelnachweisen zu arbeiten. Und nach ein paar Jahren weiß kein Mensch mehr, aus welcher von 50 Quellen eine Kleininfo stammt. Stand übrinx schon in der Erstversion von 2006 bei denen drin. --Elop 12:14, 15. Apr. 2014 (CEST)
- Ja, das steht bei Leesch so drin. Außerdem hatte Resse laut Gelsenwiki sehr wohl schon eine signifikante Bevölkerungszahl. Es geht auch nicht um Bauerschaften sondern eventuelle politische Gemeinden (westfälische Ämter bestanden flächendeckend aus Gemeinden). Für die Existenz einer Gemeinde Scholven oder Resse gibt es keinerlei Indizien, auch nicht für eine temporäre Eingemeindung von Resse und Scholven in die Gemeinde Westerholt.--Definitiv (Diskussion) 19:34, 16. Apr. 2014 (CEST)
Ich habe in dortigem Artikel auf der Diskussionsseite Zweifel an den Änderungen des heutigen Tages durch dich geäußert. Es mag sein, dass diese unbegründet sind, denn in die Thematik habe ich mich nicht genauer eingelesen. Mich macht aber stutzig, dass du den Begriff Höhendorf durch Höhengemeinde ersetzt hast. Höhendorf erscheint aber ein angesichts einer seit vielen Jahren dazu bestehenden BKS ein feststehender Begriff zu sein. Gegebenenfalls kannst du dort ja selbst schon die Zweifel ausräumen. Gruß,--Losdedos (Diskussion) 18:51, 16. Apr. 2014 (CEST)
- Habs geändert. Die Formulierungen sind jetzt erstmal wasserdicht und quellentreu. Wer darüberhinaus noch was über Höhendörfer (warum auch immer, in einem verwaltungsgeschichtlichen Zusammenhang) erzählen will, kann das gerne einbauen.--Definitiv (Diskussion) 19:13, 16. Apr. 2014 (CEST)
- Wie gesagt, ich habe es inhaltlich nicht geprüft und ob Höhendörfer in verwaltungsgeschichtlichem Zusammenhang in den Artikel gehören kann ich auch nicht sagen, aus dem Bauch heraus spricht da aber nichts gegen. Dass der Begriff im verwaltungsrechtlichen/kommunalrechtlichen Zusammenhang nicht in den Artikel gehört, da würde ich mit dir untere Umständen übereinstimmen. Mir jedenfalls ist der Begriff auch abseits der Gemeindeordnung noch nicht untergekommen. Allerdinsg träfe selbiges auf den Begriff Höhengemeinde zu (den du ja nun zwischenzeitlich wieder entfernt hast). Durch den Einbau dieses Alternativbegriffs kamen meine Zweifel dann aber erst auf. Höhendörfer erscheint mir aber zumindest ein Begriff zu sein, der im Artikel durchaus Erwähnung finden sollte, wenn er bereits einmal drin war, ggfs. dann in einem verwaltungsgeschichtlich nicht verbundenen Zusammenhang, denn irgendwo raus scheint dieser Begriff seine Daseinsberechtigung abzuleiten. Gruß,--Losdedos (Diskussion) 19:24, 16. Apr. 2014 (CEST)
Quellentip
[Quelltext bearbeiten]- 1887: http://wiki-de.genealogy.net/w/index.php?title=Datei:WestfGemLex1887.djvu&page=24&page=24
- 1897: http://www.lwl.org/westfaelische-geschichte/portal/Internet/finde/langDatensatz.php?urlID=1248 S. 18f
Benutzerkennung: 43067 16:43, 8. Mai 2014 (CEST)
- Danke für die Links, ich werd sie mal nach und nach mit den westfälischen Landkreis- und Ämter-Artikeln abgleichen. Für die Rheinprovinz gibt es für 1885/1888 auch ein Online-Gemeindeverzeichnis: http://www.digitalis.uni-koeln.de/Gemeinde/gemeinde_index.html Gruß --Definitiv (Diskussion) 08:32, 9. Mai 2014 (CEST)
- Die Rheinprovinz-Statistiken habe ich in mehreren Jahrgängen bis 1930 zuhause vorliegen, danke trotzdem für den Hinweis. Für 1830 ist auch der Restorff sinnvoll: http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10014034_00005.html .
- Danke für die Links, ich werd sie mal nach und nach mit den westfälischen Landkreis- und Ämter-Artikeln abgleichen. Für die Rheinprovinz gibt es für 1885/1888 auch ein Online-Gemeindeverzeichnis: http://www.digitalis.uni-koeln.de/Gemeinde/gemeinde_index.html Gruß --Definitiv (Diskussion) 08:32, 9. Mai 2014 (CEST)
- Für eine Übersicht der die westfälichen Gemeinden und ihre zahlreichen geografischen Änderungen im Laufe der Zeit ist Stephanie Reekers: Die Gebietsentwicklung der Kreise und Gemeinden Westfalens 1817–1967. Aschendorff, Münster Westfalen 1977, ISBN 3-402-05875-8 ein sehr schöner Literaturtipp, auch wenn sich hier und da ein paar Ungenauigkeiten eingeschlichen haben. Benutzerkennung: 43067 16:59, 9. Mai 2014 (CEST)
Hallo Definitiv, hast Du zu der Quellenangabe in o.g. Karte noch nähere Hinweise, insbesondere auf den Urheber der Karte? Liegt Dir die Karte vor? Vielen Dank für Deine Mithilfe, Yellowcard (D.) 15:37, 21. Mai 2014 (CEST)
- Es handelt sich um den "Großer Verkehrsplan Berlin und seine Vororte", gezeichnet von Alfred Mende, Geographisch-Lithographisches Institut, erschienen im Verlag Alfred Mende, Berlin SO26, Oranienstraße 176. Laut Aufdruck 1907 erschienen als Beilage zum "Adressbuch für Berlin und seine Vororte" (welches ich jedoch nicht habe). Die 1906er-Ausgabe ist hier detailliert beschrieben. Die dortigen Angaben dürften auch weitgehend für die 1907er-Ausgabe gelten.--Definitiv (Diskussion) 13:43, 28. Mai 2014 (CEST)
- Hallo Definitiv, vielen Dank – das ist schonmal sehr hilfreich! Besonders interessant wäre für uns jetzt das Todesjahr vom Kartenzeichner, also von Alfred Mende. Ich habe da auf die Schnelle nichts finden können, auch nicht auf der von Dir verlinkten Seite. Hast Du da irgendeine nähere Info? Danke und Gruß, Yellowcard (D.) 17:15, 5. Jun. 2014 (CEST)
Höxter und der mit 97,8 Prozent der CDU gewählte nichtt erwähnte Bürgermeisterkandidat Uwe Schünemann
[Quelltext bearbeiten]entweder du entschuldigst dich bei mir für deine Ausfälle, oder ich mache auch mal den wikipedia üblichen Denunzianten und melde dich wegen deines persönlichen Angriffs.
--Über-Blick (Diskussion) 22:52, 27. Mai 2014 (CEST)
- Du scheinst ja echt vom Schünemann besessen zu sein. Ein Fall von Schünemanie?. Meine Herrn, sein ganzes Denken und Tun auf so einen abgehalfterten Provinzpolitiker zu fixieren, der sozusagen aus der Zweiten Bundesliga abgestiegen ist und jetzt in die Kreisliga wechseln möchte, das muss man erst mal bringen. Nicht dass das nicht dein gutes Recht wäre, aber musst du deswegen wirklich die Diskussion:Höxter#Uwe Schünemann mit lauter überflüssigen Weblinks zuspammen? Und nochmal, der Mann wird entweder in der Stichwahl im Juni zum BM von Höxter gewählt, dann wird genau dieser Fakt in den Artikel Höxter eingetragen (und nicht ein Satz mehr und nicht einen Tag eher), oder er verliert die Stichwahl und dann bleibt der Mann mit seinem Artikel Uwe Schünemann bestens bedient (in dem du dich gerne hemmungslos und nach Belieben austoben darfst). Aber lass bitte Höxter in Ruhe.--Definitiv (Diskussion) 23:43, 27. Mai 2014 (CEST)
Zeche Hoffnung (Essen-Heidhausen)
[Quelltext bearbeiten]Was soll diese Verschiebung, lt. der Quelle (Huske) war das Bergwerk in Essen Werden. Wenn die Stadt Essen irgendwann mal eine Flurbereinigung getätigt hat und die Stadtbezirksgrenzen geändert hat, so spielt das doch wohl keine Rolle. Gruß --Pittimann Glückauf 13:25, 23. Jun. 2014 (CEST)
- Wenn die Stadt Essen ihre Stadtbezirksgrenzen geändert hat, dann spielt das sogar eine ziemlich große Rolle. Wir kategorisieren in der WP nach aktuellen Grenzen; erstaunlich dass dir das neu ist. Deswegen ist zum Beispiel Danzig unter Polen einkategorisiert und nicht unter Deutschland. Und wenn neue Ortsteile wie Hamburg-HafenCity oder Hamburg-Sternschanze eingerichtet werden, dann schaffen wir ratzfatz neue Kategorien dafür und hängen dort alles ein was da reingehört, egal zu welcher kommunalpolitischen Einheit diese Gebiete früher gehörten.--Definitiv (Diskussion) 13:33, 23. Jun. 2014 (CEST)
- Und irgendwann kommt der Nächste und sagt der Text stimmt ja gar nicht mit dem Buch überein. Wenn man sowas ändert dann fügt man dafür auch einen Beleg an, damit derjenige der das liest auch weiss warum das geändert wurde. --Pittimann Glückauf 13:39, 23. Jun. 2014 (CEST)
- Ein impliziter Beleg stand bereits im Artikel (Straße Wintgenhof), ein anderer wurde explizit als Verschiebegrund genannt. Im übrigen gabs hier auch gar keine Verschiebung von Ortsteilgrenzen, das betreffende Gebiet des heutigen Ortsteils Heidhausen gehörte auch vor 1929 nie zur Stadt Werden sondern zur Gemeinde Siebenhonnschaften, die zwar zur Bürgermeisterei Werden, aber eben nicht zur Stadt oder Gemeinde Werden gehörte.--Definitiv (Diskussion) 13:48, 23. Jun. 2014 (CEST)
- Guck mal genau hin aus welchem Jahr das Bergwerk stammt, nicht 1929 sondern 1805. Zu diesem Zeitpunkt gehörte das Gebiet in dem sich das Bergwerk befand sicherlich zu Werden. Aber darüber lohnt es eh nicht zu streiten. Mir geht es in erster Linie darum, dass wenn jemand einen Artikel verschiebt er erstens hierfür auch eine Quelle im Artikel anfügt und zweitens auch alle Verlinkungen entsprechend ändert. Dafür gibt es die Spezial Linkliste. Ich will Dir auch gerne erklären warum: Dadurch das Du den Artikel auf ein anderes Lemma verschoben hast und den Ort entsprechend im Artikel geändert hast, verliert der durch die Verschiebung entstandene Redirect seine Notwendigkeit und kann gelöscht werden da ja der Name nicht im Zielartikel vorkommt. Achtet jetzt ein Admin bei der Löschung nicht auf die noch vorhandenen Verlinkungen und löscht, so entstehen etliche Rotlinks und ggf. wird auf den neu verschobene Artikel nicht verlinkt und der landet dann in der QS weil der MerlBot ihn als verwaist erkennt. Dadurch gibbets u.U. wieder Ärger und weitere Arbeit etc. Hinzu kommt dieses Bergwerk ist in verschiedenen Fachbüchern so genannt und wird unter Essen-Werden angegeben, zapp schon ist der nächste Ärger vorprogrammiert. Ich will Dir keine Vorschriften machen und auch den Artikel nicht wieder auf das alte Lemma zurückrevertieren, auch wenn der Artikel aus meiner Feder stammt, aber IMO wäre es eleganter gewesen wenn Du das Lemma gelassen hättest und im Artikel vermerkt hättest, dass das ehemalige Bergwerk sich heute auf Heidhausener Gebiet befindet. Mit der entsprechenden Quelle in Form eines Einzelnachweises wäre das auch noch eine Zusatzinfo für den geneigten Leser geworden. Dann noch einen Redirect und die Sache wäre perfekt. Glückauf --Pittimann Glückauf 14:18, 23. Jun. 2014 (CEST)
- Glückauf auch zurück, aber auch 1805 gehörte das Gebiet in dem sich das Bergwerk befand bzw. der heutige Essener Ortsteil Heisingen mit Sicherheit nicht zur Stadt Werden sondern nur zu einer der Honnschaften der Bürgermeisterei/Mairie Werden, siehe [15] und [16]. Siehe auch die, wie an den Hektar-Zahlen gut zu sehen ist, äußerst geringe Größe der damaligen Städte im Landkreis Essen, zu denen immer nur das eigentliche und engere Stadtgebiet gehörte. Siehe auch Stift Werden#Verwaltungsgliederung vor 1803.--Definitiv (Diskussion) 14:39, 23. Jun. 2014 (CEST)
- Guck mal genau hin aus welchem Jahr das Bergwerk stammt, nicht 1929 sondern 1805. Zu diesem Zeitpunkt gehörte das Gebiet in dem sich das Bergwerk befand sicherlich zu Werden. Aber darüber lohnt es eh nicht zu streiten. Mir geht es in erster Linie darum, dass wenn jemand einen Artikel verschiebt er erstens hierfür auch eine Quelle im Artikel anfügt und zweitens auch alle Verlinkungen entsprechend ändert. Dafür gibt es die Spezial Linkliste. Ich will Dir auch gerne erklären warum: Dadurch das Du den Artikel auf ein anderes Lemma verschoben hast und den Ort entsprechend im Artikel geändert hast, verliert der durch die Verschiebung entstandene Redirect seine Notwendigkeit und kann gelöscht werden da ja der Name nicht im Zielartikel vorkommt. Achtet jetzt ein Admin bei der Löschung nicht auf die noch vorhandenen Verlinkungen und löscht, so entstehen etliche Rotlinks und ggf. wird auf den neu verschobene Artikel nicht verlinkt und der landet dann in der QS weil der MerlBot ihn als verwaist erkennt. Dadurch gibbets u.U. wieder Ärger und weitere Arbeit etc. Hinzu kommt dieses Bergwerk ist in verschiedenen Fachbüchern so genannt und wird unter Essen-Werden angegeben, zapp schon ist der nächste Ärger vorprogrammiert. Ich will Dir keine Vorschriften machen und auch den Artikel nicht wieder auf das alte Lemma zurückrevertieren, auch wenn der Artikel aus meiner Feder stammt, aber IMO wäre es eleganter gewesen wenn Du das Lemma gelassen hättest und im Artikel vermerkt hättest, dass das ehemalige Bergwerk sich heute auf Heidhausener Gebiet befindet. Mit der entsprechenden Quelle in Form eines Einzelnachweises wäre das auch noch eine Zusatzinfo für den geneigten Leser geworden. Dann noch einen Redirect und die Sache wäre perfekt. Glückauf --Pittimann Glückauf 14:18, 23. Jun. 2014 (CEST)
- Ein impliziter Beleg stand bereits im Artikel (Straße Wintgenhof), ein anderer wurde explizit als Verschiebegrund genannt. Im übrigen gabs hier auch gar keine Verschiebung von Ortsteilgrenzen, das betreffende Gebiet des heutigen Ortsteils Heidhausen gehörte auch vor 1929 nie zur Stadt Werden sondern zur Gemeinde Siebenhonnschaften, die zwar zur Bürgermeisterei Werden, aber eben nicht zur Stadt oder Gemeinde Werden gehörte.--Definitiv (Diskussion) 13:48, 23. Jun. 2014 (CEST)
- Und irgendwann kommt der Nächste und sagt der Text stimmt ja gar nicht mit dem Buch überein. Wenn man sowas ändert dann fügt man dafür auch einen Beleg an, damit derjenige der das liest auch weiss warum das geändert wurde. --Pittimann Glückauf 13:39, 23. Jun. 2014 (CEST)
Hallo, ich möchte Dich um eine Einschätzung bitten. Es geht um folgende Quelle:
- Valentin Grübel (Bearbeiter): Gemeinde-Lexikon des Deutschen Reiches, Alphabetische Zusammenstellung der sämmtlichen selbstständigen Ortschaften und Gutsbezirke (politischen Gemeinden) ... nebst Angabe der einschlägigen Amtsgerichte, Verwaltungsbehörden, Landgerichte, Oberlandesgerichte und Regierungsbezirke, 2. verbesserte Auflage, Würzburg 1892.
In dem Buch erhebt der Herausgeber den Anspruch eine "Alphabetische Zusammenstellung der sämmtlichen selbstständigen Ortschaften und Gutsbezirke (politischen Gemeinden) im deutschen Reichsgebiete nebst Angabe der einschlägigen Amtsgerichte, Verwaltungsbehörden, Landgerichte, Oberlandesgerichte und Regierungsbezirke" [17] erhoben zu haben.
Dort werden diverse altbergische Honschaften, unter anderem auch exemplarisch Diepensiepen (andere sind dort ebenfalls zu finden) als (laut Einleitung selbstständige) Gemeinde (Kürzel dort Gde.) aufgeführt, siehe [18]. Wie haben wir das einzuschätzen? Gruß Benutzerkennung: 43067 20:40, 19. Aug. 2014 (CEST)
- Danke für den Hinweis, werd mich da mal reinvertiefen, ausführliche Antwort in Kürze.--Definitiv (Diskussion) 16:06, 20. Aug. 2014 (CEST)
So, die „Rezension“ hat leider etwas länger gedauert:
Ein fürwahr bizarres Buch. Aus der Einleitung könnte man erstmal glasklar schließen, dass es sich um ein Verzeichnis der "politischen Gemeinden" des Deutschen Reichs handelt, dass also für Preußen alle Städte, alle Landgemeinden und alle Gutsbezirke gelistet werden. "Selbständige Ortschaften" ist allerdings schon ein relativ unklarer Nebelbegriff. Aber gut, schaun wir mal ins Verzeichnis und suchen ein paar preußische politische Gemeinden, die um die Zeit nachweislich existiert haben. Oops:
- Dreihonnschaften, Landkreis Essen, fehlt!
- Hardenberg, Kreis Mettmann, fehlt!
- Hoberge-Uerentrup, Landkreis Bielefeld, fehlt!
- Lämershagen-Gräfinghagen, Landkreis Bielefeld, fehlt!
- Niederdornberg-Deppendorf, Landkreis Bielefeld, fehlt!
- Hohenbudberg-Kaldenhausen, Kreis Moers, fehlt!
- Nordrheda-Ems, Kreis Wiedenbrück, fehlt!
- Siebenhonnschaften, Landkreis Essen, fehlt!
- Zweihonnschaften, Landkreis Essen, fehlt!
- Obrighoven-Lackhausen, Kreis Rees fehlt!
- Ossum-Bösinghoven, Landkreis Krefeld, fehlt!
- Quadrath-Ichendorf, Kreis Bergheim, fehlt!
Man glaubt ein Muster zu erkennen. Der Autor scheint Gemeinden mit zwei oder mehr Ortschaften nicht so richtig zu mögen und deswegen systematisch wegzulassen. Wirklich? Nein, nicht wirklich, denn
- Altendorf-Ulfkotte, Landkreis Recklinghausen, ist sehr wohl gelistet!
- Heeren-Herken, Kreis Rees, ist gelistet!
- Haffen-Mehr, Kreis Rees, ist gelistet!
- Breitscheid-Selbeck, Landkreis Düsseldorf, ist gelistet!
Einen richtigen Plan hat der gute Mann bei Bindestrichgemeinden also nicht, aber vielleicht hat er wenigstens mitbekommen dass es speziell im preußischen Münsterland oft vorkam, dass Kernort und umliegende Bauerschaften in zwei politische Gemeinden gegliedert waren. Schaun wir also mal in den Kreis Beckum.
- Stadt Beckum ist gelistet. Gemeinde Kirchspiel Beckum? Fehlanzeige!
- Stadt Oelde ist gelistet. Gemeinde Kirchspiel Oelde? Fehlanzeige!
- Stadt Sendenhorst ist gelistet. Gemeinde Kirchspiel Sendenhorst? Fehlanzeige!
Das mit dem "vollständigen Verzeichnis aller politischen Gemeinden" können wir also vergessen. Schaun wir lieber mal, was er so alles listet und wie er seine Einträge klassifiziert. Dankenswerterweise fügt er ja jedem "Ortsnamen", den er listet, einen klassifizierenden Zusatz hinzu und liefert auf Seite VII dazu eine praktische Legende. Mal schaun, was es da neben Städten, Gemeinden, Gutsbezirke noch so alles gibt: Kolonien, Bauerschaften, Hüttenwerke, Kossätenstellen, Vorstädte, Weiler, Einöden, Glashütten. Moment mal - war nicht eben noch von politischen Gemeinden die Rede?? Sollten wir es hier eventuell doch nur mit einem Ortschaftsverzeichnis zu tun haben? Könnte das dafür z.B. der Grund dafür sein, dass das Dorf Düssel gelistet ist, was bekanntlich weder politische Gemeinde noch Honnschaft noch sonst eine Verwaltungseinheit war? Egal, wir geben Herrn Grübel noch eine Chance. Wir nehmen einfach mal alle politischen Gemeinden im Regierungsbezirk Düsseldorf, die mit A anfingen (Stand Ende 19.Jhd.) und schaun wie der Herr Grübel sie klassifiziert:
- Gemeinde Aldekerk, Kreis Geldern wird als "Kirchdorf" bezeichnet
- Gemeinde Allrath, Kreis Grevenbroich wird als "Kirchdorf" bezeichnet
- Gemeinde Alpen, Kreis Moers wird als "Flecken" bezeichnet
- Gemeinde Alpsray, Kreis Moers wird als "Bauerschaft" bezeichnet
- Gemeinde Alstaden, Landkreis Mülheim an der Ruhr wird als "Dorf" bezeichnet
- Gemeinde Altendorf, Landkreis Essen wird als "Bauerschaft" bezeichnet
- Gemeinde Altenessen, Landkreis Essen wird als "Bauerschaft" bezeichnet
- Gemeinde Altkalkar, Kreis Kleve ...fehlt ganz
- Gemeinde Amern Sankt Georg, Kreis Kempen wird als "Dorf" bezeichnet
- Gemeinde Amern Sankt Anton, Kreis Kempen wird als "Dorf" bezeichnet
- Gemeinde Anrath, Landkreis Krefeld wird als "Kirchdorf" bezeichnet
- Gemeinde Appeldorn, Kreis Kleve wird als "Dorf" bezeichnet
- Gemeinde Asberg, Kreis Moers wird als "Dorf" bezeichnet
- Gemeinde Asperden, Kreis Kleve wird als "Dorf" bezeichnet
Das war also auch nix. Politische Gemeinden werden von Herrn Grübel als alles mögliche bezeichnet, bloß nicht als ...... Gemeinden! Ganz am Rande: Die von Herrn Grübel als "Dorf" bezeichneten Dörfer waren in Wirklichkeit alle auch "Kirchdörfer".
Aber was bezeichnet Grübel denn nun explizit als Gemeinde? Von den Dingern gab es im Kaiserreich mehrere Zehntausend, die müssen doch seine Liste eigentlich ziemlich dominieren. Schaun wir uns Seite 1 seiner Liste an: Oops, nur eine Gemeinde (Aastrup). Schaun wir uns Seite 2 seiner Liste an: Oops, wieder nur eine Gemeinde (Achtum-Uppen). Schaun wir uns Seite 3 seiner Liste an: Schon besser, drei Gemeinden! Aber schon auf Seite 4 wieder nur eine einzige Gemeinde. Der gute Mann scheint also ein massives Problem mit dem Gemeindebegriff zu haben. Das wird auch bei seiner Behandlung des Kreises Mettmann deutlich:
- Die Gemeinde Schöller nennt er Dorf
- Die Gemeinde Millrath nennt er Dorf
- Die Gemeinde Gruiten nennt er Dorf
- aber ausgerechnet Obgruiten nennt er Gemeinde
Von den Mettmanner Stadtteilen nennt er
- Niederschwarzbach Honschaft
- Obschwarzbach Honschaft
- Obmettmann Bauerschaft
- erwähnt er die alte Honschaft Laubach gar nicht
- ....und Diepensiepen schließlich nennt er Gemeinde (obwohl Diepensiepen damals Teil der Stadt Mettmann war).
Auch mehrere Ortsteile von Wülfrath und Hardenberg nennt er fälschlicherweise Gemeinde (wobei er dann wieder ausgerechnet den wichtigsten Ortsteil der Gemeinde Hardenberg, nämlich Neviges als "Dorf" bezeichnet)
Zusammenfassend: Das Verzeichnis von Grübel ist alles, bloß kein auch nur annähernd richtiges oder brauchbares Gemeindeverzeichnis für die damalige Zeit. Offenbar diente dieses Verzeichnis hauptsächlich dem Zweck, jeder deutschen Ortschaft, egal welchen Status die nun hatte, das zuständige Amtsgericht und den zuständigen Landkreis zuzuordnen. Mit amtlichen und glaubhaften Gemeindverzeichnisse für den Regierungsbezirk Düsseldorf sind wir ansonsten bereits gut versorgt:
- diese Liste aus 1850
- diese Liste aus 1861
- diese Liste aus 1865
- diese Liste aus 1873
- diese Liste aus 1888
- diese Listen aus 1900/1910
- diese Listen aus den 1930er Jahren.
Gruß--Definitiv (Diskussion) 15:35, 1. Sep. 2014 (CEST)
- Gut, dann sollte man dieses Buch nur mit Vorsicht genießen. Auf zeitgenössischen Karten ist der Gemeindebegriff offenbar auch unscharf, denn mir liegen unterschiedliche Karten vor, in denen (z.B. in dem amtl. Stadtplan Elberfelds von 1901) eine "Gemeinde Oberdüssel", "Gemeinde Obensiebeneick" u.w. beschriftet sind.
- Die obigen Quellen und Listen kenne ich alle soweit auch, aber auch sie unterliegen beim Gemeindebegriff m.E. auch einem gewissen Interpretationsspielraum. Ein amtliches zeitgenössisches reines und eindeutiges Gemeinderegister ist mir bislang noch nicht über den Weg gelaufen. Gruß Benutzerkennung: 43067 17:46, 3. Sep. 2014 (CEST)
- Wenn man im 19. Jhd. von Gemeinden spricht, mus sman in der Tat gut aufpassen. Bevor die Preußen sämtliche Aspekte der öffentlichen Verwaltung haarklein regelten, war Gemeinde ein relativ unscharfer Begriff und konnte alles mögliche bezeichnen, im Gebiet des heutigen NRW konnten das üblicherweise Dörfer, Bauerschaften oder in bestimmten Regionen Honschaften sein. Oft, aber nicht immer, waren solche Gemeinden auch gleichzeitig Kirchengemeinden. Die Franzosen stülpten dem ganzen Land (sowohl in den annektierten Gebieten als auch in den französischen Satellitenstaaten) eine neue Kommunalordnung über, deren Haupteinheit die Bürgermeistereien bzw. Mairien waren. Was unterhalb der Bürgermeistereien geschah, war den Franzosen relativ egal. Das Zusammengehörigkeitsgefühl einzelner Dörfer, Bauerschaften oder Honschaften bestand zweifellos während der Franzosenzeit fort, gesetzlich geregelt war es jedoch nicht. Wohl schon in dieser Zeit bildete sich für manche Gemeinden der später sehr wichtig werdende Unterschied heraus, dass für manche ein eigener Haushalt geführt wurde und für manche nicht.
- Als die Preußen 1815 den ganzen Laden übernahmen, ließen sie zunächst unterhalb der von ihnen neu eingeführten Landkreise alles beim alten. Es gab zunächst nicht eine eine einzige Zeile preußischen Gesetzestext zur Regelung der kommunalen Angelegheiten unterhalb der Kreisebene. Als informelle Begriffe, aber ohne jede gesetzliche Grundlage, wurden seinerzeit teilweise (siehe Viebahn) die Begriffe Samtgemeinde und Spezialgemeinde verwendet; Samtgemeinde für Bürgermeistereien mit vielen Teilorten (wie z.B. die Bürgermeisterei Hardenberg) und Spezialgemeinde für eben diese Teilorte. In der Bürgermeisterei Hardenberg gab es nach dieser Ausdrucksweise 15 "Spezialgemeinden".
- In den 1820er und 1830er Jahren wurde in der Rheinprovinz und in der Provinz Westfalen erbittert darüber gestritten, wie die kommunale Gliederung nun letztendlich aussehen sollte. In beiden Provinzen wollten die einen die "undeutschen" von den Franzosen gegründeten Bürgermeistereien wieder abschaffen und jeden Einzelort zur preußischen Gemeinde machen, während die anderen am liebsten streng das französische Schema übernehmen wollten. Schließlich gab es in beiden Provinzen einen Kompromiss. Es wurden zwei verwaltungstechnische Ebenen geschaffen: 1. Alle Bürgermeistereien blieben erhalten (in Westfalen wurden sie in Amt umbenannt). 2. Alle Teilorte der Bürgermeistereien mit eigenem Haushalt (welche das waren, kann man bereits bei Viebahn sehen) wurden zu eigenen preußischen Landgemeinden. 3. Eine Bürgermeisterei/ein Amt konnte auch nur aus einer einzigen Gemeinde bestehen.
- Das alles wurde 1843/44/45 in die Tat umgesetzt und führte regional teilweise zu kuriosen Ungleichbehandlungen trotz weitgehend identischer Siedlungscharakteristik. Die ganzen Bauerschaften im Essener Nordwesten bildeten gemeinsam die große Gemeinde Borbeck, die Bauerschaften im Essener Nordosten hingegen wurden alle zu einzelnen Gemeinden-im Sinne-der-preußischen-Landgemeindeordnung. Die Honschaften der Bürgermeisterei Haan wurden mehr oder weniger alle zu eigenen Gemeinden-im Sinne-der-preußischen-Landgemeindeordnung, die Honschaften der Bürgermeisterei Mettmann jedoch nicht. Die Honschaften/Orte/Dörfer/Städte der Bürgermeisterei Hardenberg auch nicht, nicht einmal die bedeutenden Orte Langenberg und Neviges. In Langenberg führte das zu besonders großem Unmut, und (nur) Langenberg erreichte daher in einem absoluten Sonderfall 1859, dass es als eigene Gemeinde aus Hardenberg ausgegliedert wurde.Siegfried Quandt: Sozialgeschichte der Stadt Langenberg und der Landgemeinde Hardenberg-Neviges. In: Bergischer Geschichtsverein (Hrsg.): Bergische Forschungen. Band IX. Ph. C. W. Schmidt, Neustadt an der Aisch 1971. So wie Hardenberg und Mettmann wurden im übrigen auch die Bürgermeistereien Wülfrath und Velbert behandelt (1 Bürgermeisterei = 1 Gemeinde-im Sinne-der-preußischen-Landgemeindeordnung).
- Die Verwendung des Begriffs Gemeinde reduzierte sich im 19. Jahrhundert nicht sofort auf die Gemeinden-im Sinne-der-preußischen-Landgemeindeordnung. In Landkarten, Literatur, ja sogar in amtlichen Bekanntmachungen wurden die "Spezialgemeinden" von vor 1840 teilweise weiterhin als Gemeinde bezeichnet, auch wenn sie nach 1840 keine Gemeinde-im Sinne-der-preußischen-Landgemeindeordnung waren. Offenbar wurden für die alten „Spezialgemeinden“ zum Teil auch weiterhin eigene Kataster geführt. Viele alte „Spezialgemeinden“ findet man auch heute noch als Gemarkung.--Definitiv (Diskussion) 19:43, 12. Nov. 2014 (CET)
Hallo Definitiv, ich hab' mir das mit den Ceciliengärten nicht aus den Fingern gesogen, schau mal hier[19]. Eigentümlicherweise ist dann Ceciliengärten unter Schöneberg vermerkt. Die LOR sind immer wieder ein Quell der Überraschung. Offensichtlich ist der LOR Friedenau nicht mit dem Ortsteil Friedenau identisch und zusätzlich voller Widersprüche. Grüße --Fridolin Freudenfett (Diskussion) 17:12, 20. Dez. 2014 (CET)
- Alles richtig, wir klassifizieren in der WP nach den Ortsteilen und nicht nach den LOR. Ortsteil Fiedenau ≠ LOR Friedenau. Nicht der einzige solche Fall in Berlin. Gruß --Definitiv (Diskussion) 17:19, 20. Dez. 2014 (CET)
Auf welcher Informationsbasis bestückst du diese Kategorie? Bei einigen der dort einsortierten Dörfer habe ich Zweifel, ob sie wirklich mal eigenständige Gemeinden waren... und andrere ehem. Gemeinden (z.B. Hauset) vermisse ich dort (noch). --Plantek (Diskussion) 22:03, 6. Jan. 2015 (CET)
- Siehe zunächst vor allem
- http://www.gemeindeverzeichnis.de/gem1900/gem1900.htm?rheinprovinz/malmedy.htm
- http://www.gemeindeverzeichnis.de/gem1900/gem1900.htm?rheinprovinz/eupen.htm
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_communes_avant_fusion_de_la_R%C3%A9gion_wallonne
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_anciennes_communes_en_province_d%27Anvers
--Definitiv (Diskussion) 22:43, 6. Jan. 2015 (CET)
- OK, Danke. Habe noch ein paar hinzugefügt. Vielleicht hilft das auch weiter, aber schwer zu handhaben. --Plantek (Diskussion) 10:15, 7. Jan. 2015 (CET)
- Wie man dieser Liste entnehmen kann, war z.B. Mirfeld nie eine Gemeinde in Belgien. Eigenständig war es in "vorbelgischer" Zeit, dann kam es in Belgien zur Gemeinde Heppenbach, die wiederum später nach Amel eingemeindet wurde. Mirfeld war also eine Gemeinde in Preußen, die heute in Belgien liegt. Das Einordnen in die Kat führt daher zu Ungereimtheiten... --Plantek (Diskussion) 19:52, 7. Jan. 2015 (CET)
- Alles richtig, bis auf die Schlussfolgerung. Nur diese Einordnung vermeidet Ungereimtheiten. Ehemalige Gemeinden werden nach heutigen Gebietseinheiten kategorisiert, dass heißt z.B., in der Kategorie:Ehemalige Gemeinde in Deutschland hängen ausdrücklich nur alle Gemeinden, die je auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands Bestand hatten, aber nicht ehemalige deutsche Gemeinden deren Gebiet heute im Ausland liegt. Das gilt natürlich auch umgekehrt für andere Länder. Siehe hierzu auch weiter oben auf dieser Seite die drei Diskussionen zu
- Kategorie Ehemalige Gemeinde in HH
- Bensen
- Kategorie:Ehemalige Gemeinde (Salzgitter) Gruß--Definitiv (Diskussion) 20:07, 7. Jan. 2015 (CET)
- Alles richtig, bis auf die Schlussfolgerung. Nur diese Einordnung vermeidet Ungereimtheiten. Ehemalige Gemeinden werden nach heutigen Gebietseinheiten kategorisiert, dass heißt z.B., in der Kategorie:Ehemalige Gemeinde in Deutschland hängen ausdrücklich nur alle Gemeinden, die je auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands Bestand hatten, aber nicht ehemalige deutsche Gemeinden deren Gebiet heute im Ausland liegt. Das gilt natürlich auch umgekehrt für andere Länder. Siehe hierzu auch weiter oben auf dieser Seite die drei Diskussionen zu
- Wie man dieser Liste entnehmen kann, war z.B. Mirfeld nie eine Gemeinde in Belgien. Eigenständig war es in "vorbelgischer" Zeit, dann kam es in Belgien zur Gemeinde Heppenbach, die wiederum später nach Amel eingemeindet wurde. Mirfeld war also eine Gemeinde in Preußen, die heute in Belgien liegt. Das Einordnen in die Kat führt daher zu Ungereimtheiten... --Plantek (Diskussion) 19:52, 7. Jan. 2015 (CET)
- OK, Danke. Habe noch ein paar hinzugefügt. Vielleicht hilft das auch weiter, aber schwer zu handhaben. --Plantek (Diskussion) 10:15, 7. Jan. 2015 (CET)
OHA, merkwürdige Regelung. Offenbar bin ich nicht der einzige, der darüber stolpert. Zumal der Kreis Eupen nach dieser Logik als "Ehem. Landkreis in Belgien" kategorisiert werden müsste, aber bei Kreisen gibt's offenbar wieder ne andere Regel. Egal, wenn es denn so gewünscht ist... Danke Dir! Gruss--Plantek (Diskussion) 20:58, 7. Jan. 2015 (CET)
Adelby
[Quelltext bearbeiten]Ich mußte leider deine Bearbeitung zurücknehmen. Ich finde gut, dass Du die Sachen nochmalsv versuchst durchzuprüfen, aber Kommentare wie Folklore usw. helfen da nicht wirklich weiter. In allen Büchern etc. können tatsächich Fehler vorkommen, von daher ist es gut, wenn man auf verschiedene Quelle achtet. Die von Dir herangezogene Quelle war offenbar eine Tabelle. Solche Tabellen sind aber häufig leider etwas reduziert. In diesem Fall ist Dir nach der Zeile Adelby die Zeile vor 1966 offenbar nicht aufgefallen. Es folgenen in den nächsten Zeilen die Teile der Gemeinde die vor 66 (dem Jahr des Zusammenschlusses) losgelöst von Adely existierten und es folgt indirekt der jeweilige Verbleib in der Folgezeit (Eingemeindung usw.) wobei die Bevölkerungsgröße (rechte Spalten) im Fordergrund stehen. Ideal ist die Erfassung klar nicht, aber man konnte das vermutlich damals nicht anders machen, mangels durchgehender DAten. Die Tabelle widerspricht aber nicht der Darstellung von Schlaber usw. Dennoch danke für die Quelle. In einer Zeile wird netterweise erzählt wann Adelby Tarup zugeordnet wurde, nmämlich 1872. Die Zahl fehlte noch. mfg --Soenke Rahn (Diskussion) 20:08, 27. Apr. 2015 (CEST)
- Komisch dass du auf die Kernaussage der von mir verlinkten Quelle überhaupt nicht eingehst. Dort steht "Vereinigung der Gemeinde Tarup mit der Gemeinde Sünderup zu einer Gemeinde Adelby am 1.1.1970" und warum für die Vorgängergemeinden explizit der Gebietsstand von 1966 referenziert wird, steht rechts daneben auch erklärt (Gebietsaustausch Tarup/Sünderup 1966). Ob der 1.1.70 ein Druckfehler ist (was immerhin möglich ist), wird sich leicht und abschließend klären lassen durch die bevorstehende Einsicht die genannte Fundstelle (Amtsblatt für Schleswig-Holstein, Jahrgang 1970, Seite 87). Gruß --Definitiv (Diskussion) 20:28, 27. Apr. 2015 (CEST)
- So komisch ist das nicht. ;-) Mein Rechner war ziemlich langsam und auf der von Dir verlinkten Seite habe ich nur oben die Tabelle angeschaut und halt mit Schlaber verglichen. Ich wollte eigentlich noch einkaufen und wollte da vorher noch anders abarbeiten. Also ich hatte das mit den Anmerkungen nicht richtig gesehen, was den Vorteil hat dass ich evtl. den Gedankengang von Schlaber dann nachvollzogen habe, falls er nur flüchtig diese Tabelle verwendet haben sollte. Ich habe mir das nochmals bei Schlaber angeschaut. Auf Seite 31 schreibt er: "1966 Sünderupt, Tarup und Tastrup zur Landegemeinde Adelby vereint. 1970 Adelbylund von Adelby (früher Sünderup) an Stadt abgetreten. [..] 1974 Landgemeinde Adelby eingemeindet, Tastrup wieder eigenständig. - Auf Seite 34 schreibt er: [...] Seither folgte [...] nur noch eine größere Eigemeindung, als 1974 Tarup und Sünderup Stadtteile von Flensburg wurden. Adelbylund war schon 1970 von der erst 1966 vereinigten Gemeinde Adelby an die Stadt abgetreten worden. Tastrup folge der Eingemeindung [...] nicht [...]. -- Im zweisetigen Quellen und Literatu-Verzeichnis findet sich folgender Titel: Klug, Heinz: Die Bevölkerung Schleswig-Holsteins 1867-1970. Historisches Gemeindeverzeichnis, hrsg. v. Statistisches Landesamt Schleswig-Holstein. Kiel 1972. --- Sicher könnte ein kleiner Tippfehler in dem von Dir zitierten Zahlenwerk vorliegen hinsichtlich der Fußnote zum 1.1.1970, aber insbesondere bei der Betrachtung des Satzes rechts in den Anmerkungen "Bei diesem Gebietsaustausch wurde die (namentlich nicht bezeichnete) Exklave der Gemeinde Sünderup in der Gemeinde Tarup (78 Einwohner) nach Tarup umgemeindet, anderseits das Gebiet Adelbykirche (30 Einwohner) von Tarup nach Sünderup. Wegen ihrer späteren Vereinigung (zu Adelby) [...] unerheblich." Nun ist Schlaber der Einzige der in Gänze über die Eingemeindung des Ostufers ein Buch geschrieben hat, aber ich vermute Du hast Recht, er hat da was falsch gemacht. Im Begleitheft zum Flensburgatlas von 1986, steht auf Seite 35: "Erst 1970 wird ein Teil von Sünderup (Adelbylund mit 132 ha) eingemeindet [...] 1974 werden innerhalb der Gebietsreform Tarup und der Rest von Sünderup eingemeindet (ca. 715 ha). -- Ich gehe davon aus, dass Du Recht mit deiner Quelle hast. Ich arbeite mal nachher die ganzen Artikel durch wo das offenbar falsch drinne steht und setze jeweils eine Fußnote zum offensichtlichen Fehler von Schlaber, so dass es dann auf Dauer weniger Verwwirrung gibt. Sollte bei deiner Ansicht überraschenderweise etwas anderes bei rauskommen, muß es halt zurückgenommen werden. Momentan sind die Details frisch, daher mache ich das lieber nachher, sind einige Artikel. mfg --Soenke Rahn (Diskussion) 23:12, 27. Apr. 2015 (CEST)
Kreise und Landkreise (DDR)
[Quelltext bearbeiten]Ich finde die möglichkeit schon gut, das man wegen 3 - 4 Jahren keinen eigenen Artikel erstellt. Das Problem was ich gefunden habe, ist das in den Stat. Jahrbüchern diese nicht als Kreise sondern als Landkreise bezeichnet werden. Was ich eigentlich noch sehr schlecht finde, ist , ein Kreis der DDR hatte einen TGS, aber es werden AGS benutzt was dieser nie hatte. Um diese Artikel eimal in die Richtung zubringen hatte ich mal Infoboxen eingebaut, was leider die Artikel etwas unglaubwürdig macht. Dann kam es in Sachsen zu einer Löschdiskussion, und da habe ich aufgegeben. Um irgendwann mal einen Konsens zu finden, habe ich unter Benutzer:Thomas021071/Test Kreis der DDR mal den Kreis oder Landkreis Eilenburg bearbeitet. Wenn du was besseres hast wäre ich sehr dankbar, denn mit den aufgegeben (alten) (Land)- oder Kreisen sieht es schlecht aus. eine gute Nacht wünscht --Thomas021071 (Diskussion) 23:54, 30. Apr. 2015 (CEST)
Guten Abend,
[Quelltext bearbeiten]Definitiv, Ich wurde am Sonntag von einem älteren (66) Herrn besucht, der deine Arbeit sehr hoch einschätzt. Dieser hat mir auch gleichzeitig erklärt, das ich hier etwas komisch auftrete. Dafür bitte ich um entschuldigung ! Wenn ich jemanden anschreibe, ist es nicht meine Absicht diesen in irgend einer Form zu beleidigen gegebenfalls zu wieder sprechen. Ich bitte dich trotzdem, dich mal zu melden. Mich würde noch dein Jahrgang interessieren! meiner ist 1971, vieleicht kann ich von dir auch noch was lernen. ids --Thomas021071 (Diskussion) 20:02, 15. Jun. 2015 (CEST)
- Hallo, ich habe überhaupt kein Problem mit deinen Beiträgen bzw. deinem Auftreten. Zu dem Entwurf zum Kreis Eilenburg kann ich nur sagen, das aus meiner Sicht beide Gliederungsformen möglich sind, aber zwei Infoboxen in einem Artikel immer etwas problematisch sind. Lässt man mal das Kreis/Landkreis-Problem außen vor, dann handelt es sich doch von 1952 um ziemlich denselben Kreis, wenn auch in zwei historischen Abschnitten in zwei verschiedenen Staaten. Das ist aber nicht soo ungewöhnlich, der heutige Landkreis Fulda zum Beispiel war erst ein Kreis im Kurfürstentum Hessen, dann ab 1867 in Preußen (seinerzeit ein vollkommen anderer Staat), dann ab 1871 im Deutschen Reich usf. usf. Der wird aber trotzdem in einem Artikel mit einer Infobox abgehandelt. Letztlich muss man sehen dass man alle relevanten Fakten irgendwie unterbekommt. Zur Altersfrage: Älter als Du und jünger als der oben erwähnte ältere Herr ;-) Gruß--Definitiv (Diskussion) 23:03, 15. Jun. 2015 (CEST)
Erstmal Herzlichen Dank für die Antwort.
mir wäre es wichtig, Altkreise nicht Staat zu ordnen. Es steht in jedem Lexikon zu seiner Zeit, aber heute ist das anders. Könnte man das z.B für den Land-Kreis Döbeln zusammem führen?
Und warum brauchen wir 3x Bautzen, 3x Meißen und 2x Unna (für Unna wurde mir die Erklärung schon gegeben) Leider finde ich diese nur der WP angepasst.
Wenn es mal richtig sein soll, sollte der Landkreis dort anfangen wo es ein Landkreis ist und wo dieser endet, Die IB sollte das Ende sein in den Parametern.
Für mich bedeutet das, wenn der Landkreis Göttingen vergrößert wird, gibt es wieder eine Leiche die im Keller liegt,
Meine Meinung: alles DDR wird auf Landkreis umgestellt, damit entfällt die IB der DDR, gleichzeitig werden Altkreise im Deutschen Reich mit angepasst, dass gegebenfalls es mal einheitlich wird.
Sorry. gute Nacht --Thomas021071 (Diskussion) 00:37, 16. Jun. 2015 (CEST)
Hallo Definitiv! Dein Glaube an die Unfehlbarkeit der Redakteure des Neuen Deutschlands und der Berliner Zeitung in allen Ehren, aber die Tatsachen sprechen für sich. Ich will gar nicht soweit gehen, auf die Sätze 2 und 3 des ersten Artikelabsatzes einzugehen. Sie stehen so eindeutig im Gegensatz zu den zahlreichen Sportgemeinschaften (SG), die in den Ländern teilgenommen haben, sodass sich jede Diskussion erübrigt. Ich will nur auf zwei Mannschaften des Viertelfinales hinweisen:
Die Zentralsportgemeinschaft (ZSG) Horch ist keine BSG, siehe FSV Zwickau, das gleiche gilt für die ZSG Welzow, siehe Borussia 09 Welzow. Wegen der SG Concordia Wilhelmsruh hatte ich Dich schon auf den entsprechenden Artikel FC Concordia Wilhelmsruh hingewiesen, der exemplarisch dafür steht, dass sogar noch in späteren Jahren Sportgemeinschaften ohne Trägerbetrieb existiert haben.
Bitte befasse Dich eingehend mit den genannten Artikeln und setze FDGB-Pokal 1949 wieder in seinen Ursprungszustand zurück. Gruß -- Greifen (Diskussion) 17:49, 19. Jul. 2015 (CEST)
- Hallo, der DDR-Fußball Ende 1940er/Anfang 1950er Jahre war bekanntlich unter anderem geprägt vom Dualismus zwischen den 1948/49 gebildeten Betriebssportgemeinschaften und den bereits 1945 gebildeten Sportgemeinschaften (von denen 1948/49 wiederum manche zu Betriebssportgemeinschaften wurden). Horch Zwickau hieß ab spätestens Juli 1949 "BSG Horch Zwickau" (Berliner Zeitung vom 17.Juli 1949), gegenteiliges in FSV Zwickau ist falsch. Welzow war bereits 1949 die "BSG Welzow", gegenteiliges in Borussia 09 Welzow ist falsch. Concordia Wittenau war 1949/50 (vorher und nachher jedoch nicht) die BSG von Bergmann Borsig, gegenteiliges in FC Concordia Wilhelmsruh ist falsch. Nichts kehrt hier wieder in seinen Ursprungszustand zurück, die geschilderten Fehler in den Vereinsartikeln werden vielmehr alle der Reihe nach verarztet. Je weniger zeitraubende Vandalisierungen von Dir kommen, umso schneller. Insbesondere wird aber demnächst im Artikel FDGB-Pokal 1949/50 (an dem auch nur BSGs teilnehmen durften und teilgenommen haben, keine Angst, kommen alle noch dran) die an Geschichtsfälschung grenzende Verschweigung des 1950 parallel zum FDGB-Pokal ausgetragenen DS-Pokals für trägerbetriebslose Sportgemeinschaften (Sieger SG Lauscha) korrigiert. Bekanntlich haben erst 1952 BSG und trägerbetriebslose SG gemeinsam am FDGB-Pokal teilgenommen. Insgesamt möchte ich dir aber mächtigen Respekt zollen, so ein Fall von totaler Belegresistenz trotz gleichzeitiger massiver Wissenslücken wie bei dir ist mir in der Wikipedia bislang noch nicht vorgekommen! Gruß --Definitiv (Diskussion) 19:09, 19. Jul. 2015 (CEST)Datei:Karitative Nachhilfe2.jpgDatei:Karitative Nachhilfe.jpg
- Was willst Du mit den Zeitungsausschnitten beweisen? Du kannst gerne einen Artikel zum DS-Pokal schreiben und einen entsprechenden Vermerk beim Artikel FDGB-Pokal anbringen. Im übrigen kannst Du Dir Deine Ironie sparen. Nur noch ein vorsorglicher Hinweis: ZSG = Zentrale Sportgemeinschaft, Zusammenschluss von Sportgemeinschaften (SG), in der Regel noch ohne offiziellen Trägerbetrieb. Die von Dir zur Änderung genannten Artikel stehen bei mir auf dem Schirm, Du wirst Dich auf harte Auseinandersetzungen gefasst machen können. -- Greifen (Diskussion) 19:53, 19. Jul. 2015 (CEST)
- Ich werte das jetzt mal nicht als Buhuhuhu-Einschüchterungsversuch sondern als freundliche Bitte zu sauber belegter und konstruktiver Artikelarbeit, einer Bitte der ich wie gewohnt gerne nachkomme! Zum Thema ZSG gibt es übrigens auch leicht andere Einschätzungen. Gruß--Definitiv (Diskussion) 20:30, 19. Jul. 2015 (CEST)
- Männers , ich verstehe die ganze Schärfe nicht, ganz ehrlich. Ihr wollte beide das Gleiche, historische Genauigkeit. Es bestätigt wieder meine These, das wir an vielen Vereinsartikeln arbeiten müssen, gerade beim FSV Zwickau. Bei Chemie hats ja mittlerweile schon gut funktioniert. Ich darf an der Stelle wiederholt an meine Arbeitsliste Benutzer:Scialfa/DDR-Clubs erinnern. Und wage mich kaum zu sagen, das ich immer noch Zweifel habe, ob der erste Meistertitel Sachsenring Zwickau zugeschlagen werden darf. Lösung verspräche evtl Literatur vom Deutschen Fußball-Archiv.--scif (Diskussion) 20:00, 19. Jul. 2015 (CEST)
- Bestimmt eine interessante Frage, aber alles der Reihe nach. Hier gehts jetzt erstmal darum, zu welchem der beiden Vereinstypen (betriebsgetragen/nichtbetriebsgetragen) Horch Zwickau im Sommer 1949 gehörte. Die Herren Peschke und Völkel scheinen dazu eine Meinung zu haben, aber die kriegen sicherlich auch bald was auf die Finger von unserem Sportsfreund....--Definitiv (Diskussion) 20:30, 19. Jul. 2015 (CEST)
- Was willst Du mit den Zeitungsausschnitten beweisen? Du kannst gerne einen Artikel zum DS-Pokal schreiben und einen entsprechenden Vermerk beim Artikel FDGB-Pokal anbringen. Im übrigen kannst Du Dir Deine Ironie sparen. Nur noch ein vorsorglicher Hinweis: ZSG = Zentrale Sportgemeinschaft, Zusammenschluss von Sportgemeinschaften (SG), in der Regel noch ohne offiziellen Trägerbetrieb. Die von Dir zur Änderung genannten Artikel stehen bei mir auf dem Schirm, Du wirst Dich auf harte Auseinandersetzungen gefasst machen können. -- Greifen (Diskussion) 19:53, 19. Jul. 2015 (CEST)
Arbeiterfußball in Berlin und Brandenburg 1910–1933
[Quelltext bearbeiten]Tach! Ich wollte mal fragen, inwieweit in dem o.g. Buch die Endrunden um die ATSB-Meisterschaften behandelt werden. Mir liegen zumeist nur die Kreismeister sowie die Halbfinals und die Endspiele vor. --Hullu poro (Diskussion) 14:17, 20. Nov. 2015 (CET)
- Hallo, das Buch von C. Wolter legt seinen Schwerpunkt im Textteil natürlich auf Berlin/Brandenburg, listet aber auch für jede Saison die Endrunden der Regionalmeisterschaften, meistens Halbfinale und Finale, manchmal auch weitere Vorqualifikationen, mit Austragungsort (oft neutrale Plätze) und genauem Datum sowie alle Spiele der reichsweiten Endrunden, auch mit Austragungsort und genauem Datum. Für die abgebrochene Saison 1932/33 sind sogar reichsweit alle Bezirks- und Kreismeister im ATSB gelistet. Ein paar zusätzliche Details zu den von Dir verwendeten Quellen in den ATSB-Saisonartikeln dürften sich also finden lassen. Generell lohnt die Anschaffung des Buchs auf jeden Fall. Gruß --Definitiv (Diskussion) 09:27, 21. Nov. 2015 (CET)
Weddingheld
[Quelltext bearbeiten]
Herzlichen Glückwunsch ...
[Quelltext bearbeiten].... zum 100.000. (in Worten: einhundertausendsten) Edit, der wohl in der letzten Woche gekommen sein muss. 100.000 Edits in 8 Jahren und drei Monaten sind eine stramme Leistung im Dienste unserer Enzyklopädie! Weiterhin viel Spaß bei WP. Grüße --JuTe CLZ (Diskussion) 09:00, 25. Mär. 2016 (CET)
Datei:LD Hannover.png
[Quelltext bearbeiten]Moin, du hast 2011 die Karte Datei:LD Hannover.png hochgeladen. Dort ist südlich von Bremen, westlich von Achim ein kleines Gebiet rechts der Weser der Landdrostei Hannover zugeordnet. Dieses Gebiet gehörte aber zur Landdrostei Stade und ist auf der Karte Datei:LD Stade.jpg auch entsprechend dargestellt. Könntest du die Karte eventuell korrigieren? --::Slomox:: >< 08:15, 2. Jun. 2016 (CEST)
- Stimmt, werd mich drum kümmern. Danke für den Hinweis.--Definitiv (Diskussion) 08:31, 2. Jun. 2016 (CEST)
Saisonartikel
[Quelltext bearbeiten]Moin! Erst mal Hut ab für deine Fleißarbeit. Wenn du nichts dagegen hast würde ich mich in den nächsten Wochen ein bißchen um die niedersächsischen Ligen kümmern. Damit wir uns nicht in die Quere kommen. Gruß! --Hullu poro (Diskussion) 21:36, 23. Okt. 2016 (CEST)
- Kein Problem, ich werde jetzt nur noch schaun was trotz magerer Quellenlage zu den Nachkriegsjahren im Rheinland und im Südwesten zu machen ist und dann ist erstmal gut. Gruß zurück --Definitiv (Diskussion) 10:06, 24. Okt. 2016 (CEST)
Auszeichnung
[Quelltext bearbeiten]Hallo Definitiv, meinerseits ein kleines Dankeschön für Deine gründliche Fleißarbeit bei der Erstellung dieser Biografien. Auch bei Benutzer:PfalzCondor habe ich mich entsprechend bedankt. --Furfur ⁂ Diskussion 11:37, 21. Nov. 2016 (CET)
- Dankeschön!--Definitiv (Diskussion) 12:19, 21. Nov. 2016 (CET)
Verwaltungslüge
[Quelltext bearbeiten]Hallo Definitiv,
war dir der Begriff Verwaltung dort zu lasch? Jedenfalls solltest du das mAn nicht ersatzlos streichen, sondern ggf. ersetzen durch "Teil der russ. Föderation" o.ä. Gruß --Georg0431 (Diskussion) 11:10, 17. Okt. 2017 (CEST)
- Nach dem Zweiten Weltkrieg gelangten besagte Gebiete "unter sowjetische Verwaltung". Dieser Vorbehalt wurde von der Bundesrepublik bis in die 1960er Jahre vertreten. Seit dem Moskauer Vertrag von 1970, spätestens aber seit dem Zwei-plus-Vier-Vertrag von 1990 stehen diese Gebiet allerseits anerkannt nicht mehr bloß "unter Verwaltung" sondern sind integraler Bestandteil der Sowjetunion bzw. Russlands. Das diese Gebiete heute zu Russland gehören, steht jeweils bereits in der Artikeleinleitung bzw. der Infobox, siehe z.B. Selenogradsk.
- Zum Verständnis der ganzen Edits siehe aber in erster Linie Wikipedia:Redaktion_Geschichte/Archiv/2017/Jul#Geschichtsklitterung. Gruß --Definitiv (Diskussion) 11:31, 17. Okt. 2017 (CEST)
- Naja, es gab um die Jahreswende 1991/1992 insofern eine Änderung, dass diese Orte von der RSFSR innnerhalb der Sowjetunion zur Russischen Föderation übergingen. Das kann im Geschichtsabschnitt doch durchaus erwähnt werden. Mag ja sein, dass der Begriff Verwaltung hier "revisionistisch" beabsichtigt war. Ganz falsch ist er dennoch ist. Ich finde, du hast es dir hier zu leicht gemacht. Gruß --Georg0431 (Diskussion) 20:57, 17. Okt. 2017 (CEST)
- Aus der RSFSR ist 1991 im Prinzip 1:1 die Russische Föderation geworden. Letztlich war das eine Umbenennung. Ob das jetzt in jedem Artikel zu einem russischen geographischen Objekt extra erwähnt werden muss, ok, darüber kann man streiten. In den Artikeln Moskau und Sankt Petersburg steht es nicht drin. Gruß--Definitiv (Diskussion)
- Aus der RSFSR ist 1991 im Prinzip 1:1 die Russische Föderation geworden. Letztlich war das eine Umbenennung. Ob das jetzt in jedem Artikel zu einem russischen geographischen Objekt extra erwähnt werden muss, ok, darüber kann man streiten. In den Artikeln Moskau und Sankt Petersburg steht es nicht drin. Gruß--Definitiv (Diskussion)
- Naja, es gab um die Jahreswende 1991/1992 insofern eine Änderung, dass diese Orte von der RSFSR innnerhalb der Sowjetunion zur Russischen Föderation übergingen. Das kann im Geschichtsabschnitt doch durchaus erwähnt werden. Mag ja sein, dass der Begriff Verwaltung hier "revisionistisch" beabsichtigt war. Ganz falsch ist er dennoch ist. Ich finde, du hast es dir hier zu leicht gemacht. Gruß --Georg0431 (Diskussion) 20:57, 17. Okt. 2017 (CEST)


 French
French Deutsch
Deutsch
